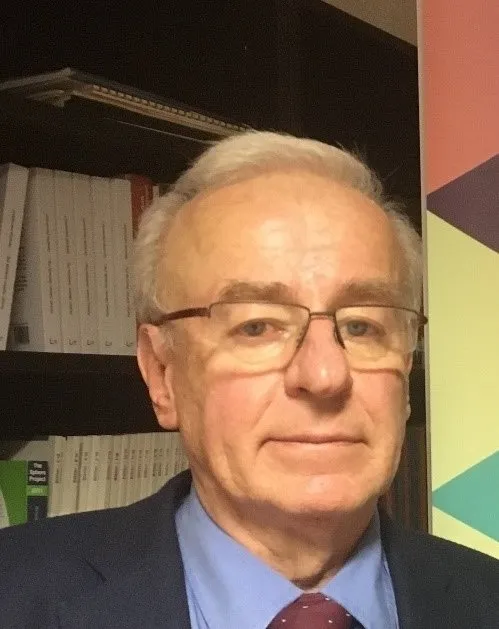Wo steht Europa im Konflikt zwischen den USA und China?
Die Gründung des neuen Bündnisses Aukus zwischen den USA, Großbritannien und Australien wurde von internationalen Kommentatoren vor allem aus Sicht des geplatzten Verkaufs französischer U-Boote an Australien betrachtet. Hinter dem Waffengeschäft steht aber eine viel weitreichendere Entscheidung. Aukus ist Teil einer globalen Bündnispolitik der USA gegenüber China. Schon im Februar stellte US-Präsident Joe Biden klar: "Kein Land der Welt kann mit uns gleichziehen, nicht China noch irgendein anderes Land." Zu diesem Zweck soll auch eine "Allianz von Demokratien" gegen die Autokratien dieser Welt auf die Beine gestellt werden. Biden geht es dabei primär um China. Er beeilte sich daher auch zu betonen, Frankreich sei ja auch für seine asiatisch-pazifische Strategie wichtig. Er scheut sich aber auch nicht, autoritäre Regierungen wie das kommunistische Vietnam oder die Philippinen für sie zu gewinnen.
Die globale Bündnispolitik der USA könnte zu drei Endresultaten führen: geopolitische und ideologische Blockbildung wie im Kalten Krieg, Hegemonie einer Supermacht oder militärische Auseinandersetzung, wie sie in der Geschichte zwischen einer etablierten und einer aufstrebenden Großmacht die Regel war.
Wo bleibt die EU in dieser globalen Auseinandersetzung, die im Indopazifik immer konkretere Formen annimmt? Aus den enttäuschten Illusionen der europäischen Nato-Mitglieder, den USA in Afghanistan Beistand leisten zu müssen und dort eine Demokratie aufbauen zu können, wurden rasch die üblichen Schlussfolgerungen gezogen: Europa bräuchte mehr militärische Kapazitäten, um von den USA "strategisch autonomer" zu sein. Das Thema wird wohl auch die Debatte über den "Strategischen Kompass" der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU bis 2022 dominieren. Dieser Schluss aus der Afghanistan-Krise ist etwas paradox, nachdem 40 Jahre militärische Interventionen der Sowjetunion und der Nato nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben. Noch paradoxer wäre es, wollte die EU in der asiatisch-pazifischen Konfrontation zwischen den USA und China militärisch eine Rolle spielen. Natürlich könnte sich Europa bedingungslos auf die Seite der USA stellen - Europas Bürger befürworten aber eine andere Option: Mehr als 60 Prozent der Europäer wollen im Konflikt mit China neutral bleiben. Im Falle einer militärischen Auseinandersetzung wäre das keine so unvernünftige Position.
Die EU könnte aber auch eine diplomatische Antwort geben. Sie könnte, verbunden mit vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen, einen Prozess nach Vorbild der KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975 einleiten, die eine erfolgreiche Konfliktverhinderungsmaßnahme am Höhepunkt des Kalten Krieges war: diplomatische Netzwerke und kooperative Sicherheit statt Feindbilder, gemeinsame Interessen und Werte über unterschiedliche geopolitische und ideologische Systeme hinweg. Die EU sollte ihre neue "Indopazifische Strategie für Kooperation" ernst nehmen. Den immer wieder vorgebrachten Einwand gegen solche diplomatische Initiativen, dafür bräuchte man doch eine glaubwürdige militärische Grundlage, widerlegt gerade Katar: Der kleine Golfstaat wird zum internationalen Zentrum für diplomatische Prozesse und Aktivitäten für die Stabilisierung Afghanistans.