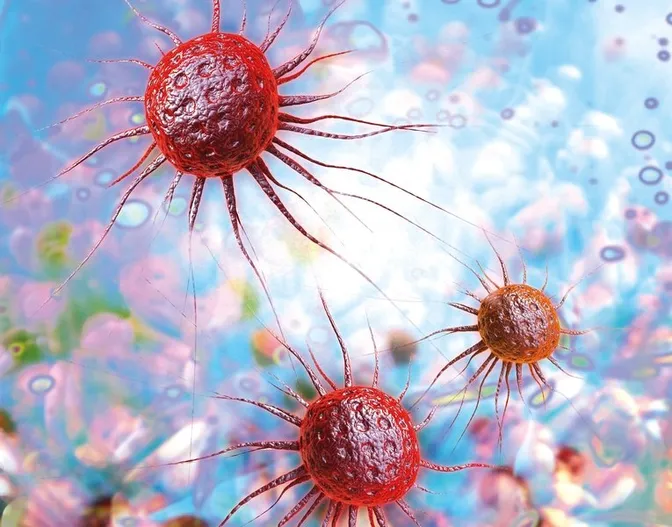Mit der Analyse genetischer Veränderungen werden Krankheiten individuell behandelbar, lautet das Versprechen.
Wien. "Durch Fehler und Irrtümer vervollkommnet sich der Mensch. Durch das Leid aber lernt er, dass alle Wege, die in Dunkelheit beginnen, zum Lichte führen müssen", wird Hippokrates zitiert. Die Präzisionsmedizin verspricht nun eine Abkürzung leidvoller Behandlungswege, punktgenau auf die erkrankte Person zugeschnitten, ohne Irrtümer, wenn sie auch oft in der Dunkelheit einer Krebsdiagnose beginnen mögen.
Ein verlockendes Versprechen für Patienten, aber auch jene, die Therapien bezahlen. Schließlich könnten mit präziseren Methoden teure Maßnahmen und Medikamente nur bei Personen eingesetzt werden, denen sie auch tatsächlich helfen. Ein Heilsversprechen, das Mediziner in der Praxis aber kritisch hinterfragen und auf realistischen, medizinisch sinnvollen Nutzen für Patienten zu reduzieren versuchen. Ein Heilsversprechen, von dem Patienten innerhalb eines Gesundheitssystems aber auch nicht aus Kostengründen ausgeschlossen sein sollen. Der Versuch einer Chancen-, Nutzen- und Kostenanalyse.
Was Präzisionsmedizin kann
Der Versuch deshalb, weil schon mit dem Begriff Präzisionsmedizin selbst Mediziner und andere Experten aus dem Gesundheitswesen Unterschiedliches meinen. Kaan Boztug, der sich am Ludwig Boltzmann Institut mit seltenen und undiagnostizierten Erkrankungen auseinandersetzt, schränkt die Präzisionsmedizin zum Beispiel auf den "Wunsch, genetische Ursachen von Erkrankungen besser zu verstehen und Therapie präzise auf diese genetische Ursache hin maßgeschneidert anwenden zu können" ein. Es gehe darum, zum Beispiel in der Krebstherapie die "molekulare Achillesferse des Tumors herauszufinden" und mit der Therapie "nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip genau an der passenden Stelle anzusetzen."
Präzisionsmedizin in der Praxis angewendet bedeutet, dass im ersten Schritt der genetische Code eines Patienten auf Veränderungen hin getestet wird. Die Methode heißt genetische Sequenzierung. Damit untersucht man die individuelle Abfolge der Bausteine im Erbgut des Menschen.
Im Falle einer Krebserkrankung versucht man dabei zum Beispiel herauszufinden, ob eine Veränderung im genetischen Code Ursache dafür ist, dass Rezeptoren an der Oberfläche der Zellen falsche Signale senden: Fehlerhafte Zellen können sich damit vor dem Immunsystem verstecken, oder es können umgekehrt zu viele Wachstumsfaktoren an den Rezeptoren andocken. Das Wachstum der Zelle wird über diesen Signalweg zwar eingeschaltet, kann aber nicht mehr abgeschaltet werden. Und die Zellen können sich unkontrolliert vermehren. "Das ist eine Definition von Krebs", sagt Boztug.
Bei Leukämie, wo das Knochenmark zu viele und zudem funktionslose weiße Blutkörperchen herstellt, ist ein solcher Signalweg häufig eingeschaltet und schaltet sich nicht mehr aus. Hier entschlüsseln Mediziner die genetische Sequenz, also die Abfolge der Bausteine der Leukämiezelle. Im Anschluss wird die Sequenz mit jener einer gesunden Zelle verglichen, um den für Zellwachstum verantwortlichen veränderten Baustein zu bestimmen, um eine punktgenaue Diagnose zu stellen und eine geeignete Therapie zu finden.
In Zellkulturen im Labor werde getestet, ob die genetisch veränderten Zellen auf ein bereits für Therapien am Menschen zugelassenes Medikament reagieren. Im Falle der Leukämie geht es etwa darum, ob es die Zelle mit dieser Mutation besser abtötet als ein anderes. Sofern die Standard-Therapie, eine Chemotherapie, nicht wirkt oder die Erfahrungen anderer Mediziner bereits gezeigt haben, dass das Medikament bei der konkreten genetischen Veränderung in Kombination mit anderen besonders gut wirkt, wird es bei Patienten eingesetzt.
Präzise Prävention
Michaela Fritz, Vizerektorin für Forschung und Innovation der Medizin-Universität Wien, erweitert die Präzisionsmedizin auf den präventiven Einsatz. Sie erklärt, dass man aus der Analyse der zunehmend größeren Menge an medizinischen Daten nicht nur die Wirkung von Therapien vorab testen, sondern auch das Auftreten von Erkrankungen mit genetischen Besonderheiten abgleichen kann - und so vorab oder in einem noch frühen Stadium nach der Diagnose die genetische Ursache einer Erkrankung kennt und Medikamente punktgenau daraufhin im Labor testen kann. "Mit Präzisionsmedizin hat man also die Chance festzustellen, ob Medikamente bei einer vorab eingegrenzten Gruppe besser wirken als bei der Masse, aber auch schon in der Entwicklung die Chancen auf ihre Wirkung später zu erhöhen", sagt Fritz. Mit Bioinformatik, künstlicher Intelligenz und Maschinen, die lernen, arbeitet die Medizin zu diesem Zweck zunehmend fächerübergreifend: "Mathematik, IT und Molekularbiologie arbeiten hier zunehmend zusammen."
Erste Lehrstühle mit solchen Kombinationen gibt es bereits, in weiterer Folge soll ab 2022 am Campus der MedUni und des Allgemeinen Krankenhauses in Wien ein Zentrum für Präzisionsmedizin errichtet werden - sofern die dafür benötigten 60 Millionen Euro per Sponsoring zusammenkommen.
Blinde Flecken
Ein durchaus teures Unterfangen, zumal Maha Nasr, Professorin und Forscherin am pharmazeutischen Department der Ain Shams Universität Kairo, zwar große Chancen der Präzisionsmedizin für die medizinische Forschung bei der Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden sieht. Zugleich wirft Nasr auch Fragen auf: zum Beispiel nach dem "blinden Fleck" bei der Erhebung und Sammlung von Gen-Daten.
Ethnische Minderheiten oder Menschen mit geringerem Einkommen kommen weniger häufig vor. "Es ist entscheidend, dass dieses Problem gelöst wird, um die Forschung in der Präzisionsmedizin zu stärken", sagt sie deshalb. Fritz sieht in Österreich Unterschiede zwischen Frauen und Männern als "relevanten Punkt", auf den die Forschung Rücksicht nehmen müsse.
Tatsächlich ist es Forschern gelungen, genetische Ursachen von Krankheiten zu entdecken und punktgenau zu behandeln. CD55 etwa, eine Krankheit, die nach dem Protein benannt wurde, das den betroffenen Patienten in ihrem Erbgut fehlt. Die Symptome der Krankheit gleichen einer schwer entzündlichen Darmerkrankung, die auch zu Thrombosen führen kann.
Vor der Entdeckung der genetischen Ursache - und vor allem dem passenden Medikament - war sie trotz des Versuchs, die Autoimmunreaktion zu unterdrücken, nur schwer in Schach zu halten. Denn in einem weiteren präzisionsmedizinischen Schritt entdeckte die Forschung, dass ein Medikament, das eigentlich für eine Erkrankung der Blutgefäße entwickelt worden war, auch bei CD55 wirksam ist. Die Therapie sei zwar teurer als die bisherige Methode, die Wirkung aber weit größer. "Damit können betroffene Kinder ein fast normales Leben führen", erklärt Boztug.
Unpräziser als gedacht
Weniger von Präzisionsmedizin überzeugt ist dagegen Claudia Wild, die das Ludwig Boltzmann Institut Health Technology Assessment, das medizinische Neuerungen und Produkte bewertet, leitet. "Präzisionsmedizin ist ein Marketingbegriff, mit dem suggeriert wird, dass eine Therapie zu hundert Prozent wirkt."
Sie spricht lieber von "stratifizierter Medizin", um die Bildung von Patientengruppen entsprechend den genetischen Ursachen einer Erkrankung oder ihrer Reaktion auf Medikamente zu umschreiben. Denn so präzise sei die Präzisionsmedizin nicht. Wild nennt das Beispiel einer bereits 2006 zugelassenen Antikörpertherapie bei fortgeschrittenem Brustkrebs, einer der ersten Therapien dieser Art: "Nur eine Frau von 18, die die Therapie erhält, überlebt länger krankheitsfrei." Alle damit behandelten Frauen aber litten unter den Nebenwirkungen.
In Zulassungsstudien teste man oft ideale Patienten, jung und ohne andere Erkrankungen, in der Realität handle es sich aber meist um Ältere mit altersentsprechend oft schlechterem allgemeinen Gesundheitszustand, um nur einige der Kritikpunkte Wilds anzuführen.
Kosten senken oder treiben?
Ist die Präzisionsmedizin geeignet, Kosten zu senken? Gesundheitsökonom Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien (IHS) stellt gewisse Sparpotenziale fest: "Bei der genetischen Sequenzierung gibt es wegen des technologischen Fortschritts einen Preisverfall." Eine Studie des IHS spricht von heute etwas mehr als 1000 Euro im Vergleich zu rund sechs Millionen Euro im Jahr 2008.
Czypionka aber wirft weitere Fragen in den Pool der vielen, die im Zuge einer Kosten-Nutzen-Analyse zu beantworten wären: "Dass Medikamente nur bei einer kleineren, dafür aber erfolgversprechenderen Gruppe eingesetzt werden, sollte die Systemkosten eigentlich senken", sagt der Gesundheitsökonom. Er sagt aber auch: "Da sich der Absatzmarkt für die Pharma-Unternehmen dadurch ebenfalls verkleinert, die Entwicklungskosten aber nicht, gibt es die Tendenz, das Medikament teurer anzubieten, um ähnlichen Profit zu erwirtschaften. Der Stückpreis stiege also."
Wobei auch das nicht zwingend so sein müsse. Mit der Testung vorab könnten sich Forschungskosten fallweise reduzieren, wegen der längeren Dauer, um die notwendige Anzahl an Patienten zu erreichen, aber auch erhöhen.
Mit den Wirkungstests vor der Verabreichung der Medikamente entstünde wiederum ein zusätzlicher Markt für die Pharmabranche - und damit Kosten für das Gesundheitswesen.
Boztug trägt das Beispiel des Neugeborenen-Screenings zur Kosten-Nutzen-Debatte von Präzisionsmedizin bei. "Das Testen jedes Neugeborenen auf Immundefekte ist zum Beispiel günstiger für die Patienten und das System." Früh erkannt, führe die Behandlung besser zum Ziel - nämlich eines gesünderen Kindes. Außerdem sei die Behandlung komplikationsloser und verursache folglich auch weniger Kosten.
Dennoch rät der Mediziner, keinen Hype um diese Art von Medizin zu machen und rational im Sinne der Patienten die realen Chancen zu erforschen. Deshalb hält Boztug es, was die Kosten der Präzisionsmedizin anbelangt, mit Mary Woodard Lasker. Die US-Amerikanerin, die sich mehrere Jahrzehnte lang für mehr Mittel für die Krebsforschung starkmachte, argumentierte schon Ende der 50er Jahre: "If you think research is expensive, try disease." - "Wenn Sie denken, dass Sie Forschung teuer zu stehen kommt, probieren Sie es mal mit einer Krankheit."