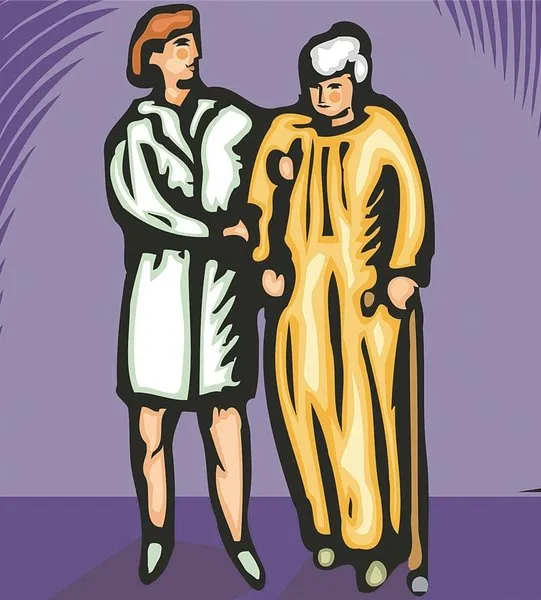Pflegewissenschafterin Christel Bienstein fordert Attraktivierung der Pflege.
Wien. Noch immer sind die Angehörigen die größte Gruppe unter den Pflegenden. Das wird sich aber radikal ändern, was zur Folge hat, dass die Personalknappheit in der Pflege sich weiter verstärkt. Der "Zukunft der größten Berufsgruppe im österreichischen Gesundheitssystem" widmet sich das Pflege-Management-Forum 2014, das von 27. bis 28. Februar in Wien stattfindet und vom Business Cercle veranstaltet wird. Erstmals wird in diesem Rahmen der Pflegemanagement-Award vergeben, 35 Projekte dafür wurden eingereicht. Die "Wiener Zeitung" sprach im Vorfeld mit Pflegewissenschafterin Christel Bienstein, einer der Referentinnen, über die Herausforderungen im Pflegesystem.
"Wiener Zeitung": Die Bevölkerung wird älter, Demenz nimmt zu, gleichzeitig gibt es eine große Qualifikations-Debatte im Pflegebereich. Haben wir ausreichend Pflegekräfte, um das alles zu bewerkstelligen?Christel Bienstein: Wir haben viel zu wenige Pflegekräfte. Das merkt man gerade auch in Wien, wo sehr viele ausländische Pflegekräfte arbeiten. Wir haben sowohl in den stationären als auch in den mobilen Diensten zu wenig Personal. Es gehen zu wenige Junge in den Beruf, weil er nicht so attraktiv ist wie vielleicht ein IT-Job. Der Beruf ist sehr stark negativ konnotiert mit Ekelberuf, weil man bei den Menschen bleiben muss. Pflegende sind immer da, sie können nicht ausweichen. Hinzu kommt, dass die Bezahlung in Pflegeberufen nicht besonders gut ist. Ein weiterer Grund, warum zu wenige junge Menschen in diesen Beruf gehen, ist die sehr starke Hierarchie - selbständige Entscheidungen, aktive Mitarbeit sind noch nicht besonders gefragt. Wir wissen, dass Arbeitsmotivation ein Stück weit auch daraus abgeleitet wird, dass man mitentscheiden kann. In den Pensionistenheimen gäbe es einen breiteren Gestaltungsspielraum, der aber nicht genutzt wird, weil die Träger eine bestimmte Regelmäßigkeit einfordern. Viele weichen aus, indem sie in Teilzeit gehen, um Luft zu holen.
Pflege ist zu 85 Prozent ein Frauenberuf. Frauen - Erzieherinnen oder Pflegerinnen - machen eine Gesellschaft durch ihre Sorgearbeit überlebensfähig, aber diese Sorgearbeit wird von der Gesellschaft viel weniger anerkannt als zum Beispiel ein Autokonstrukteur.
In Österreich findet gerade ein öffentlicher Diskurs darüber statt, das Verbot von aktiver und passiver Sterbehilfe in der Verfassung festzuschreiben und im Gegenzug Palliativmedizin und Hospizstationen auszubauen. Wie beurteilen Sie das?
Ich finde das gut. Aktive Sterbehilfe würde Pflegende viel zu sehr belasten. Es gibt Patienten, die den Wunsch äußern, sterben zu wollen. Aber oftmals ist es ein Ruf nach mehr Aufmerksamkeit, ein Wunsch, Schmerzen zu reduzieren und ihnen die letzte Lebensphase sinnhaft zu gestalten. Man kann ja Mediziner nicht verpflichten, einen Mord zu begehen. Keine Gesellschaft darf Berufsgruppen dazu zwingen, aktive Tötung zu betreiben - auch nicht per Gesetz. Ich kenne Kollegen, die Menschen in die Schweiz zur Selbsttötung begleitet haben und die danach psychisch sehr schwer erkrankt sind. Wenn aktive Sterbehilfe erlaubt ist, müssten sich Pflegende und Mediziner Angehörigen gegenüber rechtfertigen, warum man ihre Angehörigen nicht umbringt. Das wäre für Ärzte und Schwestern unzumutbar. In Deutschland wenden sich die Berufsverbände der Ärzte und Pflege eindeutig gegen aktive Sterbehilfe.
Wie gehen die Menschen in Holland oder Belgien damit um? Haben Sie da Erfahrung?
Es gibt Langzeitstudien in Holland, die klar zeigen, dass das Vorhaben, immer ein Zweitgutachten von Externen einzuholen, schon längst nicht mehr erfüllt wird. Ich bin Expertin für Wachkomapatienten und war in Holland in einer Kinderklinik. In dieser Einrichtung fand ich nur 60 Kinder. Ich fragte: "Wo sind die anderen Kinder?" Da sagte man mir: "Die sind alle tot." In Holland werden, wenn ein Kind nicht wach wird, sehr rasch die Eltern gefragt: "Sollen wir die Maschine abstellen?" Bei uns wird da viel länger zugewartet und man weiß auch, dass die Verläufe sehr unterschiedlich sein können.
Was kann Pflegewissenschaft leisten?
Ich habe gerade eine Nachtwachenstudie abgeschlossen. Man ist zutiefst betroffen, was in der Nacht von einer Person geleistet werden muss. Eine Pflegende muss in Altenheimen bis zu 60 Menschen versorgen und in Krankenhäusern bis zu 33 schwerst Erkrankte, Sterbende. Tatsächlich muss man sagen, Kranke wären in der Nacht oft sicherer zu Hause aufgehoben als im Krankenhaus. Diese Überforderung muss aufgezeigt werden. Deshalb ist die Pflegewissenschaft so wichtig. Wir müssen uns in der Pflegewissenschaft mit den Fragen der Praktiker beschäftigen und dafür sorgen, dass endlich valide Daten auf den Tisch kommen.
Wie verbreitet ist Pflegewissenschaft und wie viele Ausbildungsstellen mehr braucht es? Braucht es für jede Art der Pflege wirklich eine höhere Qualifikation und führt dies nicht dazu, dass die öffentliche Hand das System nicht mehr finanzieren kann?
In Deutschland gibt es 100 Studiengänge. Mehr als 40 Studiengänge nehmen Abiturienten auf und bilden sie parallel zum Studium zur Krankenschwester aus. Es gibt zu wenige Universitäten, die Pflegewissenschaft anbieten. Wir gehen im deutschen Wissenschaftsrat davon aus, dass 20 Prozent der Pflegenden akademisch qualifiziert sein sollen. Wenn wir in Deutschland nur zehn Prozent erreichen wollen - das wären 80.000 Akademiker -, bräuchten wir mit den bestehenden Universitätsstudiengängen 40 Jahre. An Forschungsfeldern mangelt es nicht. An der Privaten Universität Witten/Herdecke, wo ich bin, haben wir mehr als 90 Doktoranden, die alle Forschungsarbeiten machen müssen, die direkt mit den Patienten oder deren Angehörigen zu tun haben müssen, weil wir zu wenig Wissen haben.
Wenn Sie sagen: "Wir haben zu wenig Wissen", worum geht es da?
Wir wissen nicht, wie wir jemandem, der ständiges Erbrechen hat, Erleichterung verschaffen können. Wir wissen zu wenig darüber, was wir gegen die Müdigkeit bei Chemotherapien tun können. Wir wissen nicht, welche pflegerischen Unterstützungskonzepte es braucht, um Frühgeborene mit ihren Eltern gesund groß werden zu lassen. Wir wissen zu wenig darüber, wie wir Bewegungsfähigkeit im Alter aufrechterhalten können. Wir wissen weltweit nichts über Kontraktoren - also die Verrenkungen der Gliedmaßen, und und und. Wir brauchen uns über fehlende Themen keine Gedanken zu machen.
Dennoch, führt höhere Qualifikation nicht automatisch zu höheren Kosten?
Was wir bekommen werden, ist eine gestufte Ausbildung. Weniger Ausgebildete werden weniger, besser Ausgebildete mehr verdienen. Wir müssen auch nicht alle so teuer qualifizieren. Aber wir brauchen ein paar Leute, die neue Versorgungskonzepte entwickeln können. Darauf ist die allgemeine Ausbildung nicht ausgerichtet.
Was muss Pflege künftig leisten?
Sie muss sich mehr auf chronisch kranke Patienten einstellen, sie muss sich mehr auf Beratung pflegender Angehöriger einstellen, damit frühzeitig Symptome erkannt werden. Pflege im Netzwerk - interprofessionell - wird immer wichtiger. Heute werden die Menschen frühzeitig aus dem Krankenhaus entlassen. Da braucht es Zusammenarbeit mit niedergelassenen Pflegediensten, Heilpraktikern und Ärzten.
Wissen
Zur Person
ChristelBienstein
Christel Bienstein (63) leitet seit 1994 das Department für Pflegewissenschaft der Privaten Universität Witten/Herdecke (Deutschland) und ist Präsidentin des DBfK (Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe). Zahlreiche Veröffentlichungen und Mitarbeit in verschiedenen wissenschaftlichen und politischen Gremien. Forschungsschwerpunkte: Pflegeentwicklung, Professionalisierung, Qualitätssicherung.
Weder in Deutschland noch in Österreich werden Gesundheit und Pflege als Gesamtheit begriffen und behandelt. In Österreich sind die beiden Bereiche sogar in unterschiedlichen Ministerien (Sozial- und Gesundheitsministerium), in Deutschland im Gesundheitsministerium in verschiedenen Abteilungen angesiedelt. Wenn Christel Bienstein von Pflegeberufen spricht, beinhaltet das auch Krankenschwestern in den Spitälern. In Österreich wird unterschieden zwischen medizinischen Fachkräften und Pflegeberufen. Während es in Deutschland eine Pflegeversicherung gibt, gibt es in Österreich beinahe eine rein öffentliche Finanzierung des Pflegebereichs: Pflegegeld und Zuschüsse der Länder zu Pflegeheimen - sollte noch Vermögen vorhanden sein, wird dieses von den Heimen herangezogen.
In der Pflege sind derzeit in Österreich mehr als 49.000 unselbständig Beschäftigte tätig, bis 2020 werden 17.000 Pflegekräfte mehr nötig sein.
Weder in Deutschland noch in Österreich werden Gesundheit und Pflege als Gesamtheit begriffen und behandelt. In Österreich sind die beiden Bereiche sogar in unterschiedlichen Ministerien (Sozial- und Gesundheitsministerium), in Deutschland im Gesundheitsministerium in verschiedenen Abteilungen angesiedelt. Wenn Christel Bienstein von Pflegeberufen spricht, beinhaltet das auch Krankenschwestern in den Spitälern. In Österreich wird unterschieden zwischen medizinischen Fachkräften und Pflegeberufen. Während es in Deutschland eine Pflegeversicherung gibt, gibt es in Österreich beinahe eine rein öffentliche Finanzierung des Pflegebereichs: Pflegegeld und Zuschüsse der Länder zu Pflegeheimen – sollte noch Vermögen vorhanden sein, wird dieses von den Heimen herangezogen.
In der Pflege sind derzeit in Österreich mehr als 49.000 unselbständig Beschäftigte tätig, bis 2020 werden 17.000 Pflegekräfte mehr nötig sein.
Christel Bienstein (63) leitet seit 1994 das Department für Pflegewissenschaft der Privaten Universität Witten/Herdecke (Deutschland) und ist Präsidentin des DBfK (Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe). Zahlreiche Veröffentlichungen und Mitarbeit in verschiedenen wissenschaftlichen und politischen Gremien. Forschungsschwerpunkte: Pflegeentwicklung, Professionalisierung, Qualitätssicherung.