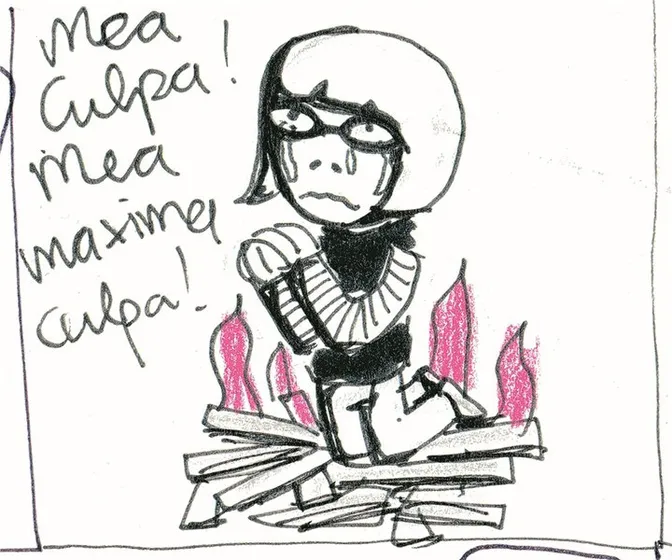Staatsanwaltschaft Graz beruft gegen Freispruch für steirischen Arzt vom Vorwurf des Quälens seiner vier Kinder.
Wien. Obwohl die Exfrau und die vier Kinder übereinstimmend von jahrelanger psychischer Gewalt des Arztes aus der Oststeiermark berichtet hatten, war dieser am Freitag vom Vorwurf des Quälens freigesprochen worden. Am Montag teilte die Staatsanwaltschaft Graz mit, dagegen berufen zu wollen. Das Urteil ist damit weiterhin nicht rechtskräftig. Der Fall geht in die nächste Instanz. Das Oberlandesgericht Graz wird sich nun damit auseinandersetzen müssen.
Dem Angeklagten war vorgeworfen worden, seine vier Kinder jahrelang gequält zu haben. Er soll sich Verletzungen zugefügt und sie gezwungen haben, ihm zu helfen. Der Beschuldigte stritt alles ab und sprach von einer "unerträglichen Situation" wegen Ehestreitigkeiten.
Nach dem Freispruch am Freitag sind die Kinder des Arztes zusammengebrochen. Opferschutzexperten sprachen von einem fatalen Urteil. "Die Betroffenen haben Angst", sagte etwa Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser, gegenüber Ö1. Denn sie trauten dem Täter "noch mehr" zu. Tatsächlich passierten bei einem Freispruch oder einer Anzeige auf freiem Fuß die meisten Morde, sagte Rösslhumer. Für Rosa Logar von der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie sei hier -vielleicht unbewusst - die Aussage eines Mannes mit öffentlichem Status als wichtig beachtet worden - was zu der dramatischen Situation führe, dass Opfer das Vertrauen in den Rechtsstaat verlieren. Tatsache ist jedenfalls, dass auf rund 2000 Anzeigen wegen sexueller Belästigung in Österreich nicht einmal 140 Verurteilungen kommen.
Mit dem Betretungsverbot und der einstweiligen Verfügung auch bei häuslicher Gewalt war Österreich im Vergleich zu anderen Ländern zwar vorbildlich unterwegs, wie auch das Grevio-Expertinnen-Komitee des Europarates bestätigte. Beispiele wie der Freispruch des Arztes oder auch der Mord eines Hohenemsers an seiner Familie Mitte September zeigen aber, dass das offenbar nicht reicht. Grevio kritisierte, dass die finanzielle Ausstattung der Gewaltprävention unzureichend sei und spezialisierte NGOs etwa für Vergewaltigung fehlten. 30 NGOs, die in der Prävention häuslicher Gewalt tätig sind, haben sich daher zur Allianz "Gewaltfrei leben" zusammengeschlossen, um Maßnahmen und deutlich mehr finanzielle Unterstützung zu fordern.
"Starker Kontrast"im Unterstützungsangebot
Im Vorjahr habe das Innenministerium für die Opferschutzeinrichtungen respektive Interventionsstellen und für die Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel insgesamt rund vier Millionen Euro ausgezahlt, heißt es dazu vom Bundeskriminalamt auf Nachfrage. Die Justiz hat laut Justizministerium für die psychosoziale und juristische Prozessbegleitung von Frauen insgesamt fast fünf Millionen Euro ausgegeben. 6446 Frauen seien als Opfer von Gewalt und gefährlicher Drohung begleitet worden. Im Budget des Frauenministeriums stehen ebenfalls fünf Millionen Euro für den Gewaltschutz zur Verfügung.
Seit 2014 ist die Istanbul-Konvention des Europarates, der erste völkerrechtliche Vertrag zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, in Kraft. Österreich war bei den ersten der heute 25 von 47 Staaten des Europarates dabei, die die Konvention ratifiziert haben. Nun wurden die Fortschritte erstmals in zwei Staaten, Österreich und Monaco, überprüft. Auch für die Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen, die von familiärer Gewalt Betroffene vor allem in rechtlichen Fragen unterstützen, stellt Grevio Österreich ein positives Zeugnis aus und spricht sogar von "Führungsrolle".
Das aber stehe in einem "starken Kontrast" zu fehlender Unterstützung bei bestimmten Formen der Gewalt wie Vergewaltigung oder für Betroffene mit speziellen Bedürfnissen wie Asylwerberinnen oder psychisch Kranke. Auch die finanzielle Ausstattung sei unzureichend.
Was braucht es also? Kerstin Schinnerl, Beraterin und juristische Prozessbegleiterin in der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, fordert als Teil der Allianz "Gewaltfrei leben" Geld für Präventionsarbeit in jenen Bereichen, die von Gewalt Betroffene oft als erstes in Anspruch nehmen. "Das Thema und wie man sich in Fällen von häuslicher Gewalt verhalten soll, sollte in die Ausbildung von Lehrern, ins Gesundheitssystem und ins Jusstudium integriert werden." Im Unterschied zu den Polizeischulen, wo es spezielle Schulungen gibt, sind spätere Richter und Staatsanwälte oft erst in der Praxis mit Gewalt an Frauen konfrontiert. Selbst gegen wiederholte Gewalttäter, wo Untersuchungsrichtern das Gefährdungspotenzial bekannt sei, werde oft keine U-Haft verhängt, sagt Schinnerl.
Dazu brauche es spezielle Beratungsstellen für von sexueller Gewalt betroffene Frauen, bei Fällen von Zwangsheirat oder Genitalverstümmelung. Rösslhumer ergänzt: Es brauche mehr Plätze in Frauenhäusern. Laut europäischem Plan wäre einer pro 10.000 Einwohnern notwendig. Aktuell gibt es österreichweit 766 Plätze; 94 fehlen: "Vor allem in ländlichen Regionen, im Wald- und im Mühlviertel und in der Steiermark sind mehr notwendig. Für Frauen in Hochrisikosituationen werden natürlich Notbetten aufgestellt." Aber es sei traurig, dass es überhaupt Wartelisten gebe, sagt Rösslhumer. 300 Frauen mussten 2016 auf einen Platz warten.
Die Allianz fordert 210 Millionen Euro für den Gewaltschutz. Laut einer Studie des EU-Parlaments von 2013 verursache Gewalt an Frauen und Kindern 450 Euro Kosten pro Bürger und Jahr: "Mit präventiven 25 Euro pro Österreicher im Jahr könnte man vieles davon verhindern", sagt Schinnerl.
Was die Parteiennach den Wahlen planen
Ob für die Prävention und den Gewaltschutz von Frauen und Kindern auch nur annähernd so viel Geld zur Verfügung gestellt wird, ist fraglich. Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner sagt, dass ihr Ministerium mit insgesamt zehn Millionen Euro "das mit Abstand kleinste Budget aller Ressorts" habe. Sofern die SPÖ nach den Wahlen einer neuen Regierung angehört, wolle man das ändern: "Im SPÖ-Wahlprogramm fordern wir zusätzliche fünf Millionen Euro für den Gewaltschutz."
Ein Rundmail des Vereins Autonome Frauenhäuser bei den anderen Parteien zeigt, dass sich sonst keine Partei vor den Wahlen auf eine bestimmte Summe festlegen will. Die Grünen verweisen auf einen Entschließungsantrag, den sie im Juli im Parlament eingebracht haben. Sie fordern darin, die Regierung möge einen fixen Fördertopf für Anti-Gewaltarbeit und Arbeit mit Gewaltopfern einrichten. Von der FPÖ heißt es nur: "Selbstverständlich ist eine Erhöhung des Budgets gerade im Sinne von Maßnahmen zur Gewaltprävention wünschenswert." Die Neos sagen, dass sich "die Förderungen des Frauenministeriums extrem stark auf Wien" konzentrieren würden. "Gerade deshalb" sei die Mittelverwendung anzupassen und seien für die Bundesländer ebenfalls ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen. Und die ÖVP? Von der erhielt der Verein bis dato keine Antwort.