Robert McElvaine, US-Historiker und Experte der "Great Depression", zieht Lehren aus den 1930ern für heute.
Robert McElvaine ist Amerikas profundester Kenner der großen Depression der 1930er Jahre, er ist auch Autor des geschichtswissenschaftlichen Standardwerks über diese Ära ("The Great Depression - America 1929-1941"). Der Welt und den USA droht heute eine neue große Depression. Daher stellt sich die Frage: Was kann man aus der Geschichte lernen?
Wiener Zeitung: Professor McElvaine, Sie haben das Standardwerk zur großen Depression der 1930er Jahre geschrieben . . .
Robert McElvaine: Immer, wenn mich Journalisten anrufen, weiß ich, dass wir schlechten Zeiten entgegensehen (lacht).

Wann war das vor der Corona-Depression der Fall?
Bei der großen Rezession nach der Lehman-Pleite im Jahr 2008. Aber dieses Mal - so fürchte ich - wird schlimmer als 2008. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Arbeitslosigkeit in den USA schlimmer wird als während der großen Depression. Zur Normalität werden wir nicht rasch zurückkehren. Eine deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Lage werden wir aber bald erleben. Das ist der Unterschied zur "Great Depression": In den 1930ern hat die Erholung der Wirtschaft sehr lange gedauert.
Um diesen externen Inhalt zu verwenden, musst du Tracking Cookies erlauben.
Welchen Begriff würden Sie für die Depression, die jetzt droht, wählen?
Manche haben "The Greater Depression" vorgeschlagen, in Anlehnung an "The Great Depression". Ich persönlich halte "The Deepest Depression" für am passendsten.
Welche Lektion hält die große Depression für unsere heutige Lage bereit?
Die Geschichte hat tatsächlich Lehren für die Gegenwart: Was hat die Regierung von US-Präsident Franklin D. Roosevelt damals getan oder unterlassen? Leider gibt es in Teilen des politischen Spektrums im heutigen Amerika eine gewisse Lernunwilligkeit: Der republikanische Vorsitzende im Senat, Mitch McConnell, sagte im Jahr 2009, nach dem Finanzcrash der Lehman-Pleite und kurz, nachdem Barack Obama Präsident wurde: "Man kann viel aus der Geschichte lernen: nämlich, dass Staatsausgaben keine Lösung für eine Wirtschaftskrise sind." Roosevelts "New Deal" habe kaum Wirkung gezeigt, sagte McConnell, die Arbeitslosigkeit sei kaum bekämpft worden. Nicht der New Deal habe die Depression beendet, sondern der Zweite Weltkrieg. Das ist ein gutes Beispiel für einen Satz, der in gewisser Weise zwar wahr, aber gleichzeitig als Argument untauglich ist, um McConnells These zu unterfüttern.
<span style="font-style: italic;">

Worin liegt die Wahrheit in McConnells Satz?</span>
Die Staatsausgaben sind zwar stark gestiegen, aber nicht ausreichend, um die große Depression zu überwinden. Als dann aber die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten, schnellten sie massiv in die Höhe, und die große Depression war praktisch über Nacht Geschichte. Für mich zeigt das, dass man aus der Geschichte lernen kann, dass Staatsausgaben sehr wohl ein taugliches Mittel sind, um einem massiven Wirtschaftseinbruch entgegenzuwirken. Das ist ein klarer Beweis, dass die Theorien des britischen Ökonomen John Maynard Keynes korrekt sind. Die Neoklassiker und Marktfundamentalisten, die den freien Markt geradezu anbeten, haben jahrzehntelang behauptet, dass Keynes unrecht hatte. Dabei haben sie selbst unrecht und kapieren das nicht.
Keynes’ Theorien haben das wirtschaftspolitische Denken in den USA bis in die 1980er Jahre beherrscht. Was ist danach passiert?
Spätestens mit dem Beginn der Präsidentschaft von Ronald Reagan im Jahr 1981 verabschiedete sich die US-Politik von keynesianischem Denken und kehrte zur alten Idee von Trickle-down-Effekten von der Oberschicht zur Unterschicht, Deregulierung und Steuersenkungen zurück. Die Folge waren immer schwerere Wirtschaftskrisen, die uns in immer kürzeren Abständen heimsuchten. Dazu kommt: Seit der Reagan-Ära ist die Vermögenskonzentration in den USA wieder auf einen ähnlichen Wert wie im Jahr 1929 gestiegen.
Was waren die Gründe der großen Depression in den 1930er Jahren?
Wachstum beruhte damals immer mehr auf Massenkonsum und damit auf Massenproduktion. Vor dieser Ära waren die Menschen, was ihre Finanzen betraf, recht vorsichtig. Sparen war eine Tugend. Die Vermögensverteilung war aber so, dass die breite Masse gar nicht über so viel Kapital verfügte, um am Massenkonsum tatsächlich teilnehmen zu können. Also bekamen die Massen Zugang zu Kapital - über Kredite. So sollten sie in die Lage gebracht werden, sich all diese schönen Autos, tollen Haushaltsgeräte und schicke Kleidung leisten zu können. Einige Jahre ging das auch gut, aber dann platzte die Blase, und die Banken gerieten in schwere Schieflage. Millionen Menschen waren verschuldet.
Sie haben McConnells Satz erwähnt, dass Staatsausgaben keine Lösung für eine Wirtschaftskrise seien. Zuletzt hat der Kongress nun aber ein Billionen Dollar schweres Hilfspaket geschnürt.
Nun gilt eben wieder das Zitat von US-Präsident Richard Nixon: "We’re all Keynesians now." Ich habe aber ein Sprichwort parat, das ebenso treffend ist: "Im Schützengraben gibt es keine Atheisten." Und in einer Depression gibt es auch keine Marktfundamentalisten.
Glauben Sie, dass diese gigantischen Hilfspakete ausreichen?
Das wird man erst sehen. Die große Depression endete ja deshalb mit dem Zweiten Weltkrieg, weil es plötzlich eine existenzielle Gefahr gab. Da spielte es keine Rolle mehr, wie viel Geld aufgewendet werden musste, um dieser Gefahr zu begegnen. Die Arbeitslosigkeit verschwand. Im Gegenteil: Plötzlich wurden Frauen in nie gekannter Zahl in den Arbeitsmarkt integriert. Die soziale Ungleichheit nahm ab, weil die Höchststeuersätze stark angehoben wurden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine unglaubliche Ausweitung der amerikanischen Mittelschicht. Sozialprogramme spielten dabei eine wichtige Rolle. Die Reichen wurden massiv besteuert, und die Gewerkschaften waren mächtig.
1929 ist eine gewaltige Blase geplatzt - am Coronavirus ist aber weder die Politik noch der Markt schuld.
Die Politik würde ich in den USA nicht aus der Verantwortung entlassen: Präsident Donald Trump wirkt in Washington wie ein Behelfssprengsatz. Alles, was in den USA bisher gegolten hat, ist während seiner Präsidentschaft in die Luft geflogen. Nun wird klar, wohin das System Trump führt: Er spaltet die Gesellschaft, zum Thema Rassismus fallen ihm nur Provokationen ein. Auf die USA entfallen mehr als ein Drittel aller Corona-Fälle. Das ist ein absolutes Desaster. Und wirtschaftlich droht nun nicht nur eine Rezession, sondern eine Depression. Allein was in China und Europa passiert ist, hätte auch in den USA eine schwere Rezession ausgelöst. Aber mit dem absoluten Missmanagement des Weißen Hauses ist nun eine Depression praktisch garantiert. Und zwar die tiefste Depression aller Zeiten, denn noch nie zuvor in der Geschichte waren alle bedeutenden Wirtschaftsblöcke der Welt synchron in derart großen Schwierigkeiten. Meine Hoffnung ist aber, dass wir aus dieser tiefen Depression vergleichsweise schnell wieder herauskommen können. Der Mensch von heute verfügt über das Wissen und die Erfahrung, wie man einer derartigen Wirtschaftsdepression begegnet.
<span style="font-style: italic;">
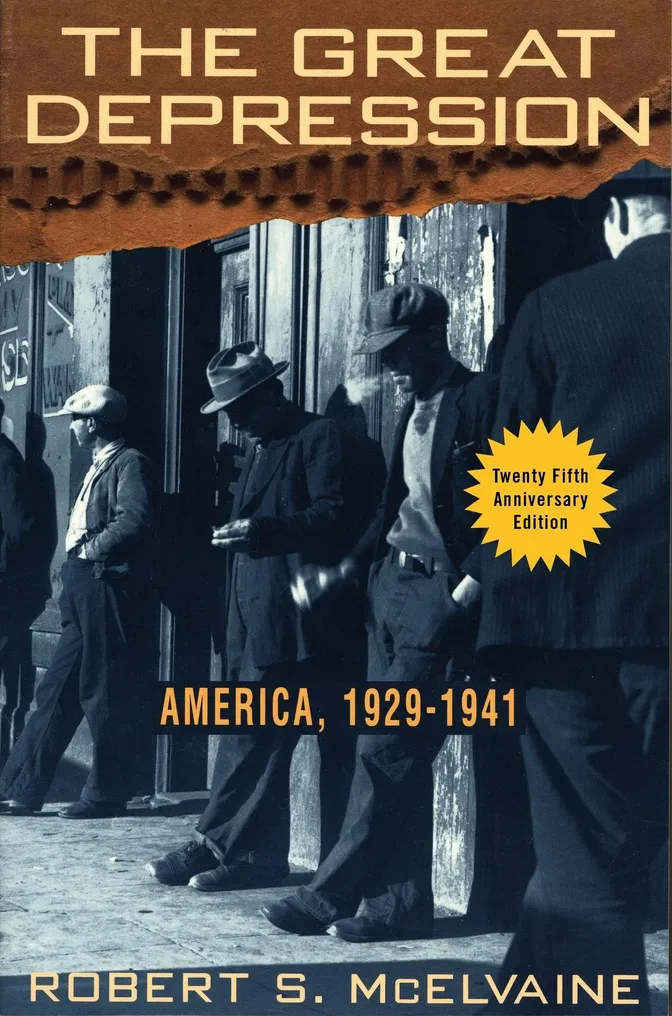
In Ihrem Buch schildern Sie, dass die Mittelschicht sich in der Zeit der großen Depression der 1930er in den USA politisch umorientiert hat. Könnte das diesmal auch passieren?</span>
Natürlich. In der großen Depression gab es zwei Entwicklungen: Die Mittelschicht war bis zu diesem Zeitpunkt der Meinung, dass ihr - damals bescheidener - Wohlstand nur auf die Früchte ihrer Arbeit zurückzuführen sei. Wenn diese Leute ihre Jobs verloren, waren sie stets der Ansicht: "Das ist meine eigene Schuld." Doch Arbeitslosigkeit war in der großen Depression ein weit verbreitetes Schicksal. Weil nun so viele von Arbeitslosigkeit betroffen waren, dämmerte den Menschen, dass nicht sie selbst daran schuld waren, wenn sie ihren Job verloren, sondern dass das System einfach nicht gut funktionierte und Schocks schlecht standhielt. Bis zum Zeitpunkt der großen Depression hatte sich die Mittelschicht kulturell - aber auch politisch - an der Oberschicht orientiert. Dort hatte man eines Tages dazugehören wollen. Nun sahen die Angehörigen der Mittelschicht die Mitglieder der Oberschicht - Banker oder reiche Unternehmer - plötzlich als geizige, kalte, herzlose Plutokraten, mit denen sie nichts zu tun haben wollten. Das könnte auch dieses Mal passieren. Weite Teile der Mittelschicht konnten in den USA schon in den Jahrzehnten vor dem Ausbruch der Pandemie nicht vom Wirtschaftswachstum profitieren. Doch bisher hat die Mittelschicht stillgehalten: Die Leute hatten das Gefühl, dass der teils obszöne Reichtum der Superreichen ihnen selbst ja nichts wegnimmt. Jetzt, wo plötzlich frühere Angehörige der Mittelschicht hinter Obdachlosen und Habenichtsen in der Schlange einer Suppenküche stehen, sieht die Sache für sie anders aus.
Sie beschreiben im Buch auch, dass die Provinz, das Landleben in der großen Depression an Attraktivität gewonnen hat.
Korrekt, aber man darf nicht vergessen, dass dem eine rasante Urbanisierung in den USA vorangegangen war. In der großen Depression hieß es dann: "Zurück aufs Land." Dort gab es wenigstens genug zu essen. Es gab zudem ein kulturelles Revival einer bestimmten idyllischen Kleinstadt-Kultur. Die Menschen hatten eine Sehnsucht nach einem idealisierten Bild des dörflichen und kleinstädtischen Lebens: Das sei der Ort, wo man einander helfe, wo es Gemeinschaftsgeist gebe und Solidarität gelebt werde. Diese Stimmung schlug sich auch in Filmen und in der Literatur nieder. Eine der großen Attraktionen der Stadt ist neben den Jobangeboten und Einkaufsmöglichkeiten vor allem das Kulturangebot. Die Stadt bietet Inspiration, aber auch Zerstreuung. Das ist in der Situation der Pandemie, in der wir uns jetzt wiederfinden, anders als zur Zeit der großen Depression. Heute sieht jeder kulturelle Ereignisse vor allem am Bildschirm - egal, ob man in der Nähe des Broadway in Manhattan oder in einer Kleinstadt in Kentucky lebt. Vergessen wir nicht: Bis es ein gut wirksames Medikament gegen Covid-19 oder eine Impfung gibt, ist die Stadt ein viel gefährlicherer Ort zum Leben als das Dorf.
<span style="font-style: italic;">
Wenn man Ihren Gedanken weiterspinnt: Bekommt in der Corona-Krise die Umweltbewegung neuen Schub?</span>
Ich bin Optimist, auch wenn manchmal die Fakten eigentlich in eine andere Richtung deuten. Aber ich denke schon, dass zumindest Umweltbewegung und Klimaschützer nun stärkeren Rückenwind bekommen. In Los Angeles sieht man plötzlich blauen Himmel statt Smog, in Indien hat man in Städten, die vorher unter einer braun-grauen Abgasdunstglocke lagen, jetzt freie Sicht auf den Himalaja. Wir haben also eine Echtzeitsimulation von dem, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Eine weitere Beobachtung: Präsident Trump und seine Sykophanten haben die Wissenschaften in der Corona-Krise verteufelt. Die Auswirkungen dieses toxischen Gemischs aus Ignoranz und Arroganz haben sich für die Menschen in den USA als katastrophal erwiesen. Jetzt sieht man die Reaktion: Die Menschen sind viel mehr an Fakten und an wissenschaftlichen Erkenntnissen interessiert als angenommen. Die überwiegende Mehrheit verhält sich in dieser Pandemie so, wie es die Wissenschaft empfiehlt. Sie erinnern sich vielleicht daran, wie Trump einmal gesagt hat, seine Fans würden ihn sogar wählen, wenn er mitten auf der 5th Avenue jemanden erschießen würde. Nun hat er wegen seiner Arroganz und Inkompetenz mehr als 110.000 Menschenleben auf dem Gewissen.
Sie wollen ihm wirklich all diese Todesopfer direkt anlasten?
Oh ja. Der erste Fall von Covid-19 wurde in Südkorea und den USA am selben Tag entdeckt. In Südkorea sind 1.500 Menschen gestorben, in den USA sind es schon mehr als 110.000. Und die Zahl steigt ständig weiter. Ich glaube, dass die Menschen jetzt schon die Bedeutung von Ärzten und Wissenschaftern neu bewerten. Das gilt auch für die Frage des Klimawandels. Ich erinnere daran, dass Trump und seine Entourage, wenn es um den Klimawandel ging, denselben Begriff verwendet haben wie jetzt in der Corona-Krise: Schwindel. Vielleicht gibt es ein paar Irre, die das auch jetzt noch tun. Beim Klimawandel ist die Zahl der Irren, die auch das für einen Schwindel halten, größer. Noch.
Glauben Sie, dass aus der jetzigen Situation so etwas wie ein planetares Bewusstsein entstehen kann? Immerhin ist die gesamte Menschheit von dieser Pandemie betroffen.
Ich bin schon lange der Meinung, dass das Einzige, das die Menschheit zusammenbringen kann, eine externe Bedrohung ist. Hollywood dachte da immer an die Landung aggressiver Außerirdischer - ein höchst unwahrscheinliches Szenario. Wenn aber schon nicht die Außerirdischen landen, dann ist dieses Virus etwas, das diesem Szenario sehr nahe kommt. Ich hoffe, dass die Menschheit dieses Virus als Chance begreift, endlich zusammenzuarbeiten. Aber man muss mit Prognosen vorsichtig sein, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen - das hat der Physiker Niels Bohr gesagt, und er hat damit verdammt recht. Denken Sie nur daran, welche unterschiedliche Entwicklung es nach der großen Depression gab: In den USA brachte Präsident Roosevelt den "New Deal" auf den Weg, in Deutschland errichtete Adolf Hitler die Nazi-Diktatur. Wir sehen etwas Ähnliches in der Gegenwart: Autoritäre Herrscher nutzen die Krise, um ihre Herrschaft zu konsolidieren. 1935 erschien in den USA der Roman "It can’t happen here" von Sinclair Lewis. Er wollte damit zeigen: Doch, was in Nazi-Deutschland passiert, kann auch in den USA passieren.
Welche Lehren hält Roosevelt aus Ihrer Sicht für die Politik von heute bereit?
Roosevelt litt an Kinderlähmung. Durch seine Krankheit war er empathiefähig. Empathie ist genau das, was dem heutigen US-Präsidenten fehlt. Roosevelt hat auch immer versucht, die Menschen zusammenzubringen und nicht zu spalten. Trump spricht immer von "Making America great again". Er beschwört die "gute alte Zeit", die 1950er und 1960er Jahre - damals waren Schwarze, Latinos und Frauen noch entrechtet. Mit dieser "guten alten Zeit" meint Trump jene Ära, in der weiße Männer in den USA das Sagen hatten. Was er freilich nicht erwähnt, wenn er über die Ära von Präsident Dwight D. Eisenhower spricht: Damals lag der Höchststeuersatz bei 90 Prozent.
Was bedeutet es eigentlich für die Menschen, wenn wir in eine neue "Great Depression" schlittern?
Die Lehren von damals: Die Menschen waren gezwungen, mit wenig auszukommen. Sie waren bereit, einander zu helfen. Es ging weniger um den Konkurrenzkampf, weniger darum, voranzukommen. Man sieht das auch in der Literatur, denken Sie an John Steinbecks "Früchte des Zorns". Es gab weniger Konkurrenzkampf, weniger Ringen um Status.
Und heute?
In Europa, in Teilen Asiens und in Nordamerika ist es durchaus möglich, dass Menschen sich die Frage stellen, ob der Konsumismus ihrem Leben wirklich Sinn gibt. Wollen wir auf Dauer ein Wirtschaftssystem, das vor allem auf Konsum aufbaut, und nicht auf dem Schaffen von gesellschaftlichem Mehrwert? Viele werden jetzt lernen müssen, dass sie auch ganz gut ohne den ganzen Kram zurechtkommen, den sie vorher für so wichtig gehalten haben. Ich habe dazu den wunderbaren Song "Finest Worksong" der US-Band R.E.M. im Ohr: In einer Textpassage heißt es da: "What we want and what we need - has been confused, been confused." Was wir begehren und was wir brauchen - das haben wir durcheinandergebracht.
Um diesen externen Inhalt zu verwenden, musst du Tracking Cookies erlauben.
Das Buch, an dem Sie gerade schreiben, beschäftigt sich mit dem Jahr 1964. Sehen Sie Parallelen zwischen den USA der 1960er und heute?
1963 hielt Martin Luther King im Rahmen des "Civil Rights March" in Washington seine berühmte Rede "I have a dream". 1964 hat Lyndon B. Johnson einen fulminanten Wahlsieg eingefahren, den "Civil Rights Act" verabschiedet und eine Menge anderer progressiver Gesetze verabschiedet. Im Sommer kam es im afroamerikanisch dominierten Stadtteil Watts in Los Angeles zu Unruhen. Es gibt aber zwei Unterschiede zwischen damals und heute: Erstens hatte Johnson die Probleme erkannt, Trump nicht. Zweitens gingen in den 1960ern fast ausschließlich Afroamerikaner für ihre Rechte auf die Straße, heute sieht man Afroamerikaner, Latinos und Weiße Schulter an Schulter für Bürgerrechte marschieren. Der Horror der 8 Minuten und 46 Sekunden, in denen der Afroamerikaner George Floyd langsam vom Polizisten Derek Chauvin erstickt wurde, hat auch die weiße Bevölkerung sensibilisiert. Heute heißt es: "Black Lives Matter." Das ist der Fortschritt gegenüber den 1960er Jahren.
Um diesen externen Inhalt zu verwenden, musst du Tracking Cookies erlauben.
Gibt es Hoffnung auf eine Renaissance in den USA?
Der britische Premier Winston Churchill hat 1947 gesagt: "Demokratie ist die schlechteste Staatsform, abgesehen von allen anderen." Die Gründer der USA haben es wohl ähnlich gesehen. Sie haben erkannt, dass die Demokratie - obwohl sie fehlerhaft ist - besser ist als jede andere Staatsform. Aber sie hatten eben auch Zweifel. Aus diesem Grund haben sie "Checks and Balances" eingebaut. Wir müssen nun erkennen, dass der Kapitalismus das schlechteste aller Wirtschaftssysteme ist, abgesehen von allen anderen. Was wir brauchen, ist ein System, dass uns erlaubt, die vielen Vorteile der Marktwirtschaft - und diese sind ja evident - zu genießen, ohne dass es gleichzeitig zu Umweltzerstörung, Armut, Elend, Ausbeutung und dieser obszönen Konzentration von Kapital an der Spitze der gesellschaftlichen Pyramide kommt. Wir brauchen also eine Art Verfassungsökonomie: Damit meine ich ein Wirtschaftssystem, das auf der Marktwirtschaft basiert, aber gleichzeitig diese "Checks and Balances" beinhaltet. Eine klug regulierte Marktwirtschaft, die innerhalb des Rahmens eines robusten Rechtsstaats existiert. Es braucht eine gesellschaftliche Kontrolle des Marktes. Ich zögere nicht hinzuzufügen: Eine Prise Sozialismus tut dem Kapitalismus nur gut. Aber zurück zu Ihrer Frage: Ich bin optimistisch, dass Trump Angesichts von heute schon mehr als 110.000 Corona-Toten in den USA, einer gewaltigen Wirtschaftskrise und Anti-Rassismus-Protesten auf den Straßen abgewählt wird. In den Geschichtsbüchern wird er als Aberration und etwas, dass es davor in der Geschichte der US-Präsidenten noch nie gegeben hat, verzeichnet werden. Ich glaube, das Jahr 2020 wird ein Wendepunkt.
Präsident Roosevelt sagte am Höhepunkt der großen Depression bei seiner Antrittsrede: "There is nothing to fear but fear itself." Was wollte er damit sagen?
Alle hatten schreckliche Existenzängste. Gerade, als er vereidigt wurde, schlossen die Banken, und es sah so aus, als ginge das ganze System unter. Die Menschen waren verängstigt. Roosevelt betrat genau zum richtigen Zeitpunkt die politische Bühne. Plötzlich war da jemand, der nicht mehr länger den alten, gescheiterten Ideen anhing. Was Roosevelt sagen wollte: "Habt keine Angst. Das Einzige, wovor ihr Angst haben müsst, ist, dass euch die Angst lähmt." Und genau das war es, was damals zu sagen war: "Fürchtet euch nicht, wir schaffen das. Gemeinsam." Wenn ich heute meinen Blick auf Washington und das Weiße Haus richte, was sehe ich da? Eine Menge politischer Führungsfiguren, die nichts anders anzubieten haben als Angst. Leute wie Trump kriegen nichts auf die Reihe, spalten, statt zu einen, tragen ungern Verantwortung, haben aber schnell Sündenböcke zur Hand.