Am kleinen Wiener Imbissklassiker werden täglich große Themen verhandelt. Er ist der heimliche Gradmesser des gesellschaftlichen Klimas. Eine Betrachtung.
Burenwurst, Käsekrainer, Frankfurter, Bosna, Waldviertler, Debreziner. Das ist - mit geringen Variationen - das Grundsortiment des traditionellen Wiener Würstelstandes. Im Jahr 1928, als der erste moderne Würstelstand in Wien aufmachte, sah das Angebot nicht wesentlich anders aus. Tradition verpflichtet, könnte man sagen. Man könnte aber angesichts dieser scheinbar in Stein gemeißelten Karte auch verzweifeln. "Der Wiener Würstelstand ist kulinarisch eine vertane Chance", schrieb der österreichische Gastronomiekritiker Tobias Müller neulich.
Gewiss: Das Schnellimbissangebot der Wiener Straßenkioske ist in den letzten 25 Jahren bunter geworden und hat sich deutlich erweitert, etwa um Dürüm, Kebab, Falafel, Pizza oder Nudeln. Und dennoch: Der Befund, dass der Würstelstand kein Eldorado für kulinarische Feinspitze war und ist, hat nach wie vor Bestand. Schließlich will er das auch gar nicht sein.
Man könnte die Sache damit bewenden lassen, schließlich wird man dem Leberkäsesemmelesser auch nicht täglich vorhalten, dass er Leberkäsesemmeln isst. Und doch fällt auf, dass der Wiener Würstelstand regelmäßig zu heftigen Debatten führt, die weit über das kulinarische Niveau hinausreichen. Die Frage, wie lange es ihn noch geben wird, ist dabei die harmloseste.
Debattiert und gestritten wird auch über Grundlegenderes: Ist das Wienerische des Würstelstandes in Gefahr? Wird er gar "überfremdet" und von "nichtwienerischen Elementen" gekapert? Woher droht ihm, wenn denn diese Diagnose überhaupt stimmen sollte, die hauptsächliche Gefahr? Es geht also um große Themen, die hier am kleinen Würstelstand verhandelt werden.
Symbolischer Spielball
Zahlenmäßig fallen die Würstelstände in der Wiener Gastronomie kaum ins Gewicht, auch wirtschaftlich gesehen fristen sie ein ziemliches Nischendasein. Aber darum geht es bei diesem "Kulturkampf" letztlich gar nicht. So klein und unscheinbar die Würstelstände im Verpflegungsnetzwerk auch sein mögen, sie scheinen eine Schlüsselrolle in der immer wieder befeuerten Konfliktzone zwischen dem "Wir" und dem "Anderen" zu spielen.
Der Würstelstand ist ein gern gewählter Austragungsort für Politik- und Kulturkämpfe aller Art. Warum wurde und wird gerade der Würstelstand zum symbolischen Spielball für gesellschaftliche Konflikte, die sich wesentlich um Fragen der kulturellen Identität, also um ganz andere Dinge als Würste, Kebab und Pizzaschnitten drehen?
Weil, so könnte man überspitzt formulieren, der Würstelstand gut sichtbar im öffentlichen Raum steht und daher leicht als Projektionsfläche für reale und eingebildete kulturelle und gesellschaftliche Reibungspunkte herhalten kann. Und, vielleicht noch wichtiger: Weil gesellschaftliche Grabenkämpfe zwischen dem "Wir" und den "Anderen" sich häufig an der Esskultur festmachen. Am Essen an sich, aber auch an den vielfältigen Praktiken und Erscheinungsformen, die im öffentlichen Raum an das Essen geknüpft sind, angefangen bei der architektonischen und grafischen Ausgestaltung der Kioske, der visuellen Darstellung des Essens in der Kiosk-Werbung, der Sprache und Lautstärke der Besucher, bis hin zur Frage der Gerüche und der Sauberkeit.

Entlang all dieser Themen werden Identitätsdebatten geführt. Wer gehört dazu, wer nicht? Man könnte auch sagen: Der Würstelstand ist so etwas wie ein heimlicher Gradmesser des gesellschaftlichen Klimas im Lande.
Wenn wir die Würstelstand-Debatten der letzten drei Jahrzehnte Revue passieren lassen, fällt auf, dass die Frontstellungen sich mehrmals verschoben haben, und zwar deutlich. "Lange hat es gedauert, doch nun ist es soweit", jubelte im fernen Jahr 1988 das Nachrichtenmagazin "Profil". "Endlich machen auch in Wien immer mehr türkische Imbißstuben McDonald’s und dem Würstelstand Konkurrenz."
Konsumkapitalismus
Die Gefahr drohte dieser Sichtweise zufolge also nicht aus dem Orient, sondern von der amerikanischen Fast-Food-Industrie à la McDonald’s. Die amerikanische Kette hatte 1977 die erste Filiale in Wien eröffnet und setzte in den 80er Jahren zum Siegeszug in ganz Österreich an. Würstelbude und Kebab-Lokale sollten ihr, so wird hier gefordert, vereint Paroli bieten. Noch 2006 hieß es im Magazin "News": "Kebab & Würstelstand setzen dem McDonald’s-Wachstum hierzulande - noch - Grenzen."

Doch bald sollte sich diese imaginierte Allianz gegen die Übermacht des Konsumkapitalismus auflösen. Denn das Wachstum der amerikanischen Ketten war durch die tatkräftige Mithilfe der Kebab-Bude nicht zu stoppen. Auch nicht, als in den letzten Jahren immer mehr alteingesessene Würstelstände mit Kebab-Ständen fusionierten und ein breites Sortiment an Fast Food anboten.
Klassischer Würstelstand und Multikulti-Kioske mit gemischtem Imbissangebot, beide sind seit der beginnenden Jahrtausendwende auf dem Rückzug. Zum einen setzten ihnen die erwähnten Ketten zu, zum anderen in noch größerem Maße die neuen Online-Lieferdienste wie Foodora, Mjam oder Lieferservice. Nicht die türkischen, später asiatischen und zuletzt syrischen Standler, sondern die Auswirkungen der digitalen Revolution und der globalisierten Servicedienstleistungen läuteten den allmählichen Niedergang der Straßenkioske ein. Erstaunlich aber ist, dass diese letzte Wende im öffentlichen Würstelstand-Diskurs weit weniger Niederschlag gefunden hat als die türkische Ankunft am Würstelstand Jahre zuvor.
Der "Volkszorn" richtet sich nicht gegen die einfallenden digitalen Essensportale, sondern immer noch gegen die orientalische "Gefahr". Als 2016 in Wien ein Halal-Würstelstand aufmachte, waren die Wellen der Empörung bis in den letzten Winkel des Boulevards zu spüren. "Geht der Wiener Würstelstand unter? Keine Sorge: Würstelstände wird es immer geben", beruhigte schon vor etlichen Jahren Josef Bitzinger, Spartenobmann in der Wiener Wirtschaftskammer und selbst Würstelstand-Betreiber, in einem Interview.
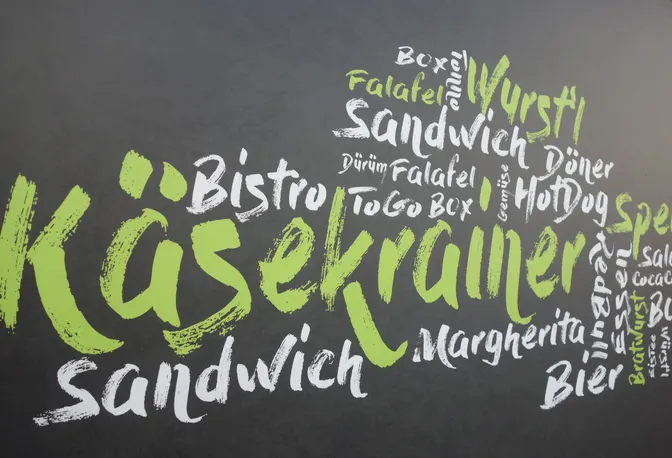
Und er sollte Recht behalten: Zwar gibt es heute zahlenmäßig deutlich weniger Stände als noch vor zehn Jahren. Aber die bestehenden Kioske haben ihre Nischen gefunden. Bitzingers eigene Kioske etwa erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Im jüngsten "Falstaff"-Würstelstand-Ranking für das Jahr 2019 belegt der Unternehmer Rang drei, hinter dem "Alt-Wiener Würstelstand" am Volkstheater und dem "Scharfen René" am Schwarzenbergplatz.
In der Angst um das Verschwinden des Würstelstands zeigt sich die Brüchigkeit des gesellschaftlichen Selbstbewusstseins - und zugleich die Urangst vor dem Fremden. Je mehr dieser Ort zum Austragungsplatz symbolischer Kulturkampf-Debatten wurde, desto öfter tauchte der Würstelstand als - häufig klischeebeladener - Sehnsuchtsort auf: Denken wir nur an die Krimiserie "Kottan ermittelt", in der der Würstelstand als Treffpunkt für Hiesige und Fremde, für Proleten und Freaks, Gescheite und Gescheiterte regelmäßig auftaucht. Und kaum ein Wien-Krimi der letzten Jahre will auf den Würstelstand als zwielichtige Projektionsfläche im öffentlichen Raum verzichten.
Je mehr reale Würstelstände aus dem Stadtbild verschwanden, desto mehr wurde am Fantasieort Würstelstand gebastelt. Wer Wien wirklich kennenlernen will, so raten fast alle neueren Reiseführer, müsse das am Würstelstand tun. Kulinarisch ist hier nach wie vor nicht viel zu gewinnen, atmosphärisch aber sei man, so heißt es, am Würstelstand im Herzen der Stadt angelangt.
Als Adolf Kottan im Jahr 2010 nach 27 Jahren noch einmal für eine Filmfolge (Regie: Peter Patzak) in den Polizeidienst zurückkehrte, bestellte er sich am Würstelstand "a Haße und a 16er-Blech". Im Inneren der Bude bediente ihn, wie könnte es anders sein, ein Migrant. "Bar jeder Hoffnung" heißt der Kiosk im Film.
Anton Holzer, geboren 1964, ist Fotohistoriker, Publizist, Ausstellungskurator und Herausgeber der Zeitschrift "Fotogeschichte". www.anton-holzer.at
