Die Aufgabe der Soziologie ist nicht, gesellschaftliche Sichtweisen zu bestätigen, sondern sie zu hinterfragen. Das gilt speziell bei Phänomenen wie Populismus oder Digitalisierung.
Ein Soziologe stellt komische Fragen - und er gibt komische Antworten. Das sagte der in München lehrende Soziologe Armin Nassehi kürzlich bei einem Auftritt in Wien. Wobei mit "komisch" keineswegs - obwohl nicht generell ausgeschlossen - "Lustiges" gemeint ist, also keine Komik (oder eher nur eine unfreiwillige), sondern komisch im Sinne von nicht erwartbar, überraschend oder unorthodox. Soziologie, und das kann nicht oft genug betont werden, ist eine Wissenschaft, die gesellschaftliche Gewissheiten und Selbstbeschreibungen hinterfragt - und dabei oftmals, nicht immer, zu anderen Erkenntnissen gelangt als zu den "üblichen", "gewohnten".
Neue Perspektiven
In den letzten Jahren hat es sich allerdings eingebürgert, dass Soziologen - in Medien zu allem und jedem befragt - oft das allzu Erwartbare sagen, gesellschaftliche (Vor-)Urteile nur beredt wiederholen, womit sie ihre eigene Profession gefährlich untergraben, denn es ist und bleibt ihre ureigene Aufgabe, hinter soziale Übereinkünfte zu blicken, diese gegebenenfalls auch zu korrigieren, statt sie einfach nur zu bestätigen. Auch wenn Soziologen selbst keinen Standpunkt außerhalb ihres Beobachtungsfeldes, also des Sozialen, einnehmen können, so gibt es doch methodische Perspektiven und Möglichkeiten, einen distanzierteren, analytischeren Blick auf soziale Zusammenhänge zu werfen, als das in alltäglicher oder medialer Kommunikation möglich ist.
Daher ist Soziologie auch nur dann interessant, wenn sie zu anderen Sichtweisen und Schlüssen kommt, als es die immergleichen medialen oder politischen Stereotype vorgeben, ohne dass diese deswegen schon zwangsläufig fake news sein müssen. Sie brauchen mitunter eine theoretische Ergänzung, ein Korrektiv oder eben einen anderen Blickwinkel, um als weitgehend absichtslose Scheingewissheiten erkannt zu werden.
Gerne hätte ich hier das Buch "Die Gesellschaft des Zorns. Rechtspopulismus im globalen Zeitalter" von Cornelia Koppetsch als Paradebeispiel für solch eine Vorgangsweise angeführt, allerdings ist die in Darmstadt lehrende Soziologin kürzlich, im Umfeld des Bayerischen Buchpreises, für den ihr heuer erschienenes Werk nominiert war, in ein schräges Licht geraten. Es sind Plagiatsvorwürfe aufgetaucht, problematische Zitationsformen, die nun von einer Kommission geprüft werden. Bis dahin wurde das Buch, das viel Lob eingeheimst hatte und mittlerweile in einer zweiten, teilweise korrigierten Auflage erschienen war, vom Markt genommen. Daher kann man vorläufig schwerlich selbst daraus zitieren, solange nicht ganz klar ist, von wem die jeweiligen Stellen nun wirklich stammen.
Das ist schade, denn Koppetsch, eine bisher renommierte Sozialwissenschafterin, hatte in dem nunmehr inkriminierten Buch auf sehr differenzierte und immens detailreiche Weise (und da fangen halt die Herkunftspro-bleme stets an, wenn man derart viel Material heranschafft) dargelegt, wie die landläufige Sicht auf den grassierenden Rechtspopulismus viel zu kurz greift - und sie hatte vor allem auf die blinden Reflexionsflecken vieler ihrer Zunft- und Standesgenossen hingewiesen, die ihren eigenen sozialen Standort allzu leichtfertig ausblenden und sich moralisch-politisch "auf der richtigen Seite" wähnen.
Theorie des Singulären
Koppetsch hatte rechtspopulistische Parteien nicht nur als "Symptomträger", deren politischen Meinungen keinerlei Bedeutung beizumessen ist, betrachtet, sondern als durchaus ernstzunehmende politische Akteure. Was freilich gar nichts mit einer etwaigen Sympathie oder ideologischen Nähe zu diesen Positionen zu tun hat. (Trotzdem liegt es nahe, dass man ihr auch wegen dieser Kritik an der akademischen Kurzsichtigkeit und Überheblichkeit besonders genau auf die Finger geschaut hat.)
Dabei wollen wir es hier belassen. Manche Standpunkte dürften, wie Koppetsch mittlerweile eingestanden hat, vom deutschen Soziologen Andreas Reckwitz übernommen - und also solche ungenügend ausgewiesen - worden sein. Damit sind wir bei einem jener Sozialwissenschafter, die auf exemplarische Weise zweite Blicke auf soziale Übereinkünfte und Konstruktionen werfen - und dabei zu anderen, neuen, frischen Einsichten gelangen.

Spätestens seit seinem Buch "Die Gesellschaft der Singularitäten" (2017), in dem Reckwitz den Strukturwandel der Moderne untersucht, ist der in Frankfurt/Oder lehrende Wissenschafter zum Paradetypus eines "verstehenden" und "erklärenden" Soziologen geworden, der neue Orientierungspläne für eine scheinbar unübersichtliche Gegenwart vorlegt.
Es sind vor allem seine detaillierten Ausführungen zur Spätmoderne, mittels derer Reckwitz anschaulich zu zeigen vermag, wie sich ein auf industrielle Produktion stützender Kapitalismus längst in eine vorwiegend mental-kulturelle Erscheinungs- und Produktionsform verwandelt und weiterentwickelt hat, die nicht mehr auf Materialismus und Gleichförmigkeit, sondern auf immaterielle Werte, spezifische Dienstleistungen und kulturelle Besonderheiten setzt.
Mit dem Begriff der Singularität erweitert Reckwitz den soziologisch etwas schwachbrüstigen der Individualität, der sich zu einschränkend nur auf menschliche Belange bezieht, während das Singuläre eben auch im Ökonomischen und Kulturellen, somit in Waren, Marken und Kunstwerken zum Ausdruck kommt.
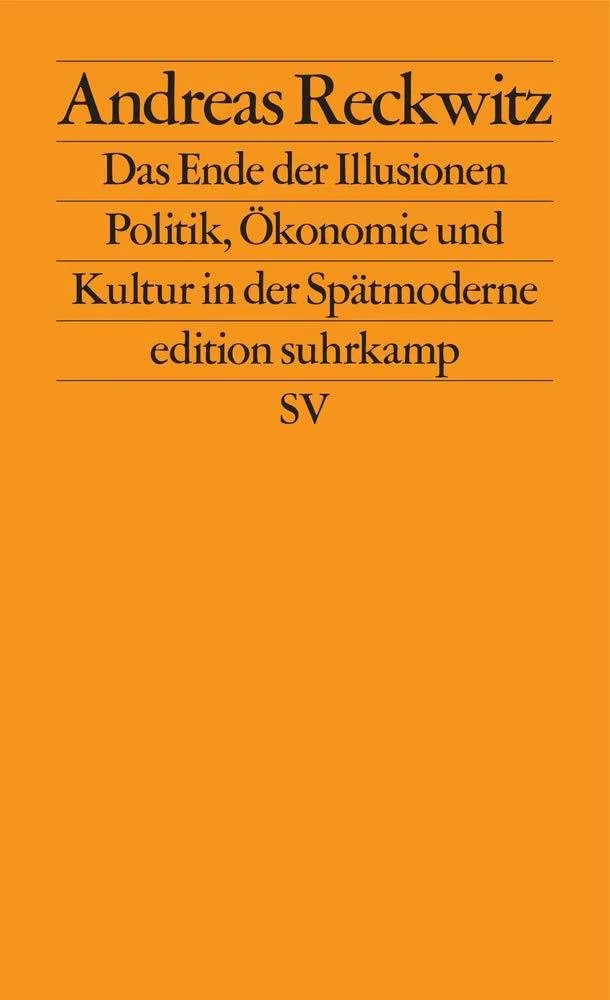
Vor wenigen Wochen hat der Soziologe diesem Zentralwerk einen Essayband folgen lassen, "Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne", in dem er seine Theorie in einzelnen gesellschaftlichen Teilbereichen genauer spezifiziert. Darin zeigt er u.a. auf sehr plausible Weise, wieso man mit dem herkömmlichen Links-Rechts-Schema die heutigen Dynamiken, Veränderungen und Verwerfungen nicht mehr recht (be-)greifen kann. Er schlägt stattdessen, wie er auch in einem Aufsatz in der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" kürzlich ausgeführt hat, die Unterscheidung von Regulierung und Dynamisierung vor.
"Das Regulierungsparadigma dominierte das Regierungshandeln in den westlichen Ländern von links bis rechts bis in die 1970er-Jahre hinein. Es war ein erfolgreiches Paradigma, welches Massenwohlstand und sozialen Zusammenhalt sicherte - dann jedoch geriet es in eine tief greifende Krise und kollabierte innerhalb eines Jahrzehnts."
Es waren vor allem Überregulierungen in der Ökonomie, die Arbeitslosigkeit und Verschuldung mit sich brachten, und in der Kultur, die den individuellen Freiheits- und Entfaltungswillen hemmten, was in der Folge, etwa ab dem Schlüsseljahr 1968, zu einer Dynamisierung aller Lebensbereiche führte. Der "Neoliberalismus" war die ökonomische, marktoffensive und somit eher rechte Antwort darauf, der "Kulturliberalismus" die eher linke, mit einer Öffnung hin zu mehr Individualrechten, auch für Frauen und Minderheiten, und einer generellen Förderung kultureller Vielfalt.
"Auch wenn Neo- und Linksliberalismus zeitweise miteinander verfeindet waren, stellen sie sich doch beide als zwei Seiten eines liberalen Paradigmas der Entgrenzung heraus, dessen gemeinsamer Gegner die Regulierung der Nachkriegszeit war: Es ging um eine Entfesselung der Märkte und der Identitäten..." (Reckwitz)
Mittlerweile schlägt das Pendel wieder in die andere Richtung - und die gegenwärtigen Krisen in Ökonomie, Politik und Kultur sind, so schlägt Reckwitz als Erklärungsmuster vor, aus einer überbordenden Dynamisierung entstanden, die sich quasi selbst entgrenzt hat und zu Umwelt- und Klimakatastrophen, forcierter sozialer Ungleichheit und überforderten, erschöpften Individuen führte. Auf alle diese Erscheinungen ist der (Rechts-)Populismus der Versuch einer Antwort. Für Reckwitz ein falscher, bzw. ungenügender Ansatz, da die von den Rechtspopulisten propagierte nationale Schließung ein Uraltrezept der Industriegesellschaft der Fünfzigerjahre und überdies "mit einem illiberalen Freund-Feind-Verständnis verknüpft ist".
Er plädiert stattdessen für einen "einbettenden Liberalismus", der "stärkere Vorstellungen des Sozialen und der Kultur entwickeln sowie eine aktivere Rolle des Staates vorsehen (wird), als sie im Liberalismus der Märkte und der subjektiven Rechte galten. Ein solcher einbettender Liberalismus kann stärker progressiv oder stärker konservativ ausgerichtet sein."
Es wird sich zeigen, ob er damit recht behält, aber es ist anzunehmen, da diese Einschätzung einerseits (system-)logisch ist, andererseits so vorsichtig und allgemein formuliert ist, dass darin sehr viele Entwicklungen Platz haben. Das ist auch klug, da Zukunftsszenarien nicht die Stärke der Soziologie sind, ja aus Prinzip nicht sein können. Karl-Otto Hondrich (1937-2007), ein anderer, unvergessener Frankfurter Soziologe, der stets auf so luzide wie unverwechselbare Weise Licht in scheinbar dunkle soziale Zusammenhänge brachte, hat darauf hingewiesen, dass Gesellschaften nicht aus Vorsätzen lernen, sondern aus Folgen. Und diese sind naturgemäß erst hinterher zu erkennen bzw. zu analysieren.
Trotzdem scheint eine Voraussage, die wiederum Cornelia Koppetsch in ihrem umstrittenen Buch "Die Gesellschaft des Zorns" getroffen hat und die man "gefahrlos" zitieren kann, denn es ist ihre eigene Schlussfolgerung, keineswegs gewagt zu sein: Es "mehren sich die Hinweise darauf, dass mit dem Aufstieg der populistischen Rechtsparteien auch das Politische in die Gesellschaft zurückkehrt. Die Rechtsparteien haben ein hochwirksames Gift in den Gesellschaftskörper geschleust, auf das dieser nun mit der Herausbildung von Antikörpern reagieren wird. Wenn die Zeichen nicht trügen, dann stehen uns konfliktreiche Zeiten bevor. Das muss nicht zwangsläufig eine schlechte Nachricht sein."
Wo es gegenwärtig bereits ein Übermaß an Konflikten gibt, in allen Eskalationsstufen, ist das Internet. Aber nicht dieser Aspekt einer hypertrophen, aus dem Ruder laufenden Kommunikation und einer nach moralischen und juristischen Antworten verlangenden Entwicklung interessiert den bereits eingangs erwähnten Soziologen Armin Nassehi in seinem neuen Buch, "Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft", sondern eine grundlegendere Frage, nämlich: "Für welches Pro-blem ist die Digitalisierung eine Lösung?"

Nassehi, der in der Tradition der Luhmann’schen Systemtheorie steht und, wie gesagt, in München lehrt (und die renommierte Diskurszeitschrift "Kursbuch" herausgibt), gibt auf diese Frage eine Reihe von einleuchtenden Antworten. Die verblüffendste davon ist freilich jene, dass die Digitalisierung nur deswegen so erfolgreich sein kann, weil sie gesellschaftlich vorgebildet ist, sprich auf einer grundlegenden digitalen Sozialstruktur aufbaut.
Der erste "Digitalist"
Das Digitale kommt also nicht, wie landläufig angenommen oder gerne behauptet wird, wie eine fremde, in technologischen Sphären ausgeheckte Kolonialmacht über uns, nein, sie ist in ihren (digitalen) Grundlagen immer schon da. Also immer ist etwas übertrieben, obwohl etwa mit dem Prinzip Oben/Unten tatsächlich seit Anbeginn menschlicher Gemeinschaften ein digitales Sozialmodell und Urprinzip (vor-)herrschte. Wirklich wirkungsmächtig und sichtbar wird es aber seit dem 19. Jahrhundert, vor allem mit den ersten öffentlichen Sozialstatistiken. Nassehi sieht in dem "Sozialphysiker" Adolphe Quetelet (1796-1874), der als einer der Ersten statistische Verfahren auf die Gesellschaft angewendet hat, einen frühen "Digitalisten". Der Franzose hatte im Zuge dieser Verfahren erkannt, wie erstaunlich regelmäßig und berechenbar sich Menschen verhalten - etwa, wenn es ums Heiraten ging.
Regelmäßigkeit und Berechenbarkeit sind zwei Beschreibungen, die so gar nicht zum Selbstbild einer sich ständig verändernden Gesellschaft passen wollen. Ja eh, sagt Nassehi, aber: "Gesellschaft ist ein zwar fluider,
(...) ein auf Ereignissen basierender, ein schneller, ein beschleunigter Gegenstand, und doch enorm stabil, regelmäßig, in vielen Hinsichten auch berechenbar. Dieser Gegenstand enthält Muster, die man auf den ersten Blick nicht erkennt. Der zweite Blick (...) ist zunehmend ein digitaler Blick."

Man erinnere sich in diesem Zusammenhang an die "Steinzeit" der Wahlforschung, an die ersten Hochrechnungen in den 1970er Jahren (in Österreich unvergessen mit dem Namen des Statistikers Gerhart Bruckmann verbunden), als schon damals aus relativ kleinen Samples verblüffend repräsentative Aussagen und Vorhersagen abgeleitet werden konnten.
Da zeigte sich bereits, dass es mit der völlig freien, unvorhersehbaren (Wahl-)Entscheidung von Individuen nicht weit her sein konnte. Ein paar Daten, geschickt in Verbindung gesetzt und verknüpft, reichten in aller Regel schon aus, um erstaunlich treffsichere Prognosen tätigen zu können. Es ist bzw. war das gleiche Prinzip, mittels dessen heute aus Kaufentscheidungen im Internet auf umfassende Eigenschaften des jeweiligen Konsumenten geschlossen werden kann. Womit die Onlinefirmen bekanntlich ihr eigentliches Geschäft machen.
Aus der Sozialstatistik sind in weiterer Folge die empirischen Sozialwissenschaften entstanden, weshalb die Entdeckung des Digitalen ein eminent sozio-logischer Vorgang ist: "Die (...) Entdeckung der Gesellschaft ist folgerichtig ihre digitale Entdeckung. Der Siegeszug der digitalen (...) Selbstbeobachtung von auf den ersten Blick unsichtbaren Regelmäßigkeiten, Mustern und Clustern ist womöglich der stärkste empirische Beweis dafür, dass es so etwas wie eine Gesellschaft, eine soziale Ordnung gibt, die dem Verhalten der Individuen vorgeordnet ist."
Also von wegen "There’s no such thing as society. There are individual men and women ...", Margaret Thatchers einstiger berühmt-berüchtigter Ausspruch, der freilich schon damals (1987 in einem Interview geäußert) Unsinn war, aber nicht zuletzt der Erfolg digitaler Methoden beweist das Gegenteil: "Die digitale Beobachtung der Welt ist nicht in erster Linie am konkreten Individuum interessiert, sondern an bestimmten Typen..."
Vielfalt der Moderne
Wie sehr eine digitale Funktionslogik in praktisch allen gesellschaftlichen Teilbereichen steckt, demonstriert Armin Nassehi anhand simpler Grundcodierungen: "Dass sich Ökonomisches auf Zahlen/Nicht-Zahlen, Politisches auf Macht/keine Macht, (...) Mediales auf Information/Nicht-Information, Rechtliches auf Recht/Unrecht und Religiöses auf Immanenz/Transzendenzfragen konzentriert, ermöglicht erst die unglaubliche Formenvielfalt der Moderne."

Daher ist eine allzu naive Kritik am Digitalen - und damit schließt Nassehi seine überzeugende und inspirierende Darlegung - von vorneherein zum Scheitern verurteilt: "Technik setzt sich auch wider besseres Wissen durch, wenn sie funktioniert. (...) Die Digitaltechnik ist derzeit Gegenstand heftigster Erörterungen ethischer, rechtlicher, moralischer und politischer Natur - und bewährt sich tagtäglich als Technik und korrumpiert damit das gute Argument."
Auch hier wird, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen, aus den Folgen mehr zu lernen sein als aus Absichten. Und das entspricht weniger einem soziologischen als vielmehr einem Ur-Wiener Prinzip: Schauen wir einmal, dann werden wir schon sehen.
Literatur:
Andreas Reckwitz: Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne. Edition Suhrkamp, Berlin 2019.
Armin Nassehi: Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft. C. H. Beck, München 2019.
Cornelia Koppetsch:Die Gesellschaft des Zorns. Rechtspopulismus im globalen Zeitalter. Transcript Verlag, Bielefeld 2019. (Aufgrund von Plagiatsvorwürfen zurzeit vom Markt genommen; eine dritte, korrigierte Auflage ist in Vorbereitung.)
Gerald Schmickl, geboren 1961 in Wien, hat Soziologie studiert, ist Schriftsteller, Essayist und seit 1998 redaktioneller Leiter der "W.Z."-Beilage "extra"-.
