Nachdenken über den Stellenwert epidemischer Katastrophen in der Geschichte - und was daraus für die Gegenwart folgt.
Im New Orleans des frühen 19. Jahrhunderts wurden die Monate, als das Gelbfieber in der Stadt grassierte, tiempo muerto, die tote Zeit, genannt. Wer es sich leisten konnte, verließ die Stadt. Die Toten waren allgegenwärtig: in Parks, auf Karren oder im Mississippi treibend.
Die Krankheit, die Covid-19 genannt wird, ist längst nicht so tödlich wie das Gelbfieber, das in einem schlechten Jahr bis zu einem Zehntel der Bevölkerung dahinraffen kann. Doch die Wendung "tiempo muerto" betrifft auch einen Aspekt der Pandemie von 2020. Die große Entschleunigung aller Abläufe fühlte sich wie eine Umkehr der inneren Logik der Moderne an. Flüge, Vorträge, Konferenzen, Zeremonien und Versammlungen wurden abgesagt.
Für einen erfahrenen Professor, der das Haus nicht verlassen durfte, war es die ideale Zeit, ein Buch zu schreiben oder einen Essayband zusammenzustellen. Für junge Leute im akademischen Bereich hingegen gab es keine Abschlussexamina, keine Verleihung von Titeln und keine Feiern mit Freunden und Verwandten. Die Wendepunkte, auf die sie hingearbeitet hatten, die Riten, die den Übergang von einer Lebensphase in die nächste markierten, waren verschwunden. Für sie war es, als wäre die Zukunft abgeschaltet worden.
Um meine eigenen Gedanken zu ordnen und um der Welt draußen zu signalisieren, dass Historiker auch dann denken, wenn die Welt ringsherum den Betrieb einstellt, begann ich eine Reihe von Podcast-Gesprächen mit Kollegen und Kolleginnen. Wir wollten herausfinden, inwiefern das Nachdenken über die Vergangenheit uns helfen kann, unsere derzeitigen Zwangslagen zu verarbeiten. Aus diesen Diskussionen gingen ebenso vielsagende wie widersprüchliche Erkenntnisse hervor.


Das nackte Entsetzen der früheren Begegnungen mit epidemischen Krankheiten war ein interessantes Thema. Im frühneuzeitlichen Venedig und Florenz wurde, wie meine Kollegen berichteten, die Angst an sich bereits als Gefahr angesehen, weil man glaubte, sie erhöhe die Ansteckungsgefahr. Die Gesundheitsbehörden versuchten, ihr entgegenzutreten, indem sie ruhig und einfühlsam mit der Bevölkerung umgingen.
Doch das umgekehrte Problem stellte sich ebenfalls ein: Als Gesundheitsinspektoren eine Schar junger Florentiner auf dem Höhepunkt der Pestepidemie im 16. Jahrhundert bei einer fröhlichen Party antrafen, gingen sie auf einen nahen Friedhof und holten den Leichnam einer kürzlich verstorbenen jungen Frau. Sie warfen die Leiche mitten unter die Feiernden und riefen: "Sie will auch tanzen!"
Es sei ein auffälliges Merkmal der Covid-19-Pandemie, beobachteten meine Kollegen und Kolleginnen, dass unsere Fähigkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln und zu kommunizieren, zwar unvergleichlich größer sei als bei unseren Vorgängern, doch unsere Fähigkeit, die Krankheit wirklich zu bekämpfen und zu behandeln, sei (zumindest bis zur Entwicklung eines zuverlässigen Impfstoffs) längst nicht so weit entwickelt, mit der Folge, dass wir tendenziell auf Methoden zurückgriffen, die bereits mittelalterliche und frühneuzeitliche Städte anwandten: Quarantäne, Lockdown, Abstand, Masken und die Schließung von öffentlichen Einrichtungen wie Geschäften, Märkten und Kirchen.
Damals wie heute mussten die politischen Behörden die Gefahr für das Leben abwägen gegen die Gefahr für Einkommen und ökonomische Vitalität. In Handelsstädten wie New Orleans, Istanbul, Bombay (heute: Mumbai) und Hamburg war das ein schwieriger Balanceakt.

Die Maßnahmen, die die Herrschaftsgewalt anordnet, um die Gefahr einer ansteckenden Krankheit einzudämmen, beträfen stets den Kern des Gesellschaftsvertrags zwischen den Herrschern und den Beherrschten, sagte ein Kollege zu mir. Wo die Gefahr offensichtlich und die Maßnahmen vernünftig und transparent waren, war die soziale Anpassung an die Schritte zur Eindämmung der Pandemie tendenziell hoch.
Göttlicher Groll
Wo die Bevölkerung hingegen kein Vertrauen zu den Behörden hatte, konnten Bemühungen, die Ansteckung durch Verordnungen zu unterdrücken, die die Bewegungsfreiheit und wirtschaftliche Aktivität einschränkten, Proteste und Krawalle auslösen - wie heute in den Vereinigten Staaten oder im von der Pest geplagten Bombay des späten 19. Jahrhunderts. Damals lösten die von den Briten durchgesetzten Maßnahmen einen Aufstand aus, der in der Ermordung des Pest-Kommissars der Stadt und seines Assistenten kulminierte. "Die Pest hat mehr Erbarmen mit uns", schrieb der indische Nationalist Bal Gangadhar Tilak, "als ihre menschlichen Vorbilder, die derzeit die Stadt regieren."
Die Gewohnheit, Seuchen eine moralische Bedeutung zuzuschreiben, ist ebenso alt wie die schriftliche Dokumentation ihrer Auswirkungen. Im Alten Testament werden Seuchen häufig als etwas von Gott Gewolltes präsentiert. "Denn ich hätte schon meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit Pest schlagen können, dass du von der Erde vertilgt würdest", sagt der Herr im Buch Exodus (9,15) zu Mose, damit dieser den Pharao entsprechend warnt. Daraus folgte, dass Epidemien Zeichen des göttlichen Grolls waren, die wiederum Taten der Versöhnung von Seiten der Menschheit erforderten.
Die Städte des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europas hätten, teilten mir zwei Kolleginnen mit, ihre Gesundheitsmaßnahmen häufig mit Verordnungen flankiert, die Prostitution, Glücksspiel, Kartenspiel und allgemein frivoles Benehmen untersagten - mit der Begründung, diese würden eine ohnehin bereits gereizte Gottheit noch weiter provozieren.
Dabei hat es natürlich stets auch eine alternative Sichtweise gegeben. In seiner Schilderung der Pestepidemie im alten Athen kommentierte der Historiker Thukydides schelmisch, dass die Frommen und die weniger Frommen in gleicher Zahl an der Seuche starben. Im Buch Hiob ist die Seuche, erinnerte mich ein Kollege, keine Strafe, sondern die Folge einer finsteren Wette zwischen Gott und dem Satan. Da der Teufel auf Hiobs Loyalität zu Gott eifersüchtig ist, verführt er den Allmächtigen dazu, ihm die Erlaubnis zu geben, den frommen Mann auf die Probe zu stellen.
Prompt schickt der Teufel zuerst Hiobs Vieh Seuchen und Tod, dann dessen Frau und Kindern und zu guter Letzt Hiob selbst. Der gute Mann erduldet all diese Schrecken in einem Zustand tiefster Verwunderung, weil er nicht begreifen kann, warum er so arg gequält wird.
Das Bedürfnis nach einer moralischen Einsicht ist immer noch stark. Selbst im relativ säkularisierten Umfeld des heutigen Westens gibt es den Drang, die Sinnlosigkeit des Leidens und Todes zu lindern, indem man hoffnungsvoll darüber spekuliert, dass uns die Pandemie womöglich achtsamer für das ökologische Gleichgewicht unserer Welt und sensibler für die Bande der Solidarität und Interdependenz machen werde, die uns mit unseren Mitbürgern verbinden.
Soziale Ungleichheit
Man glaubt gerne, dass sich ansteckende Krankheiten gleichmäßig unter der menschlichen Bevölkerung ausbreiten wie Billardkugeln, die über einen Tisch rollen. Doch in Wirklichkeit ist ihr Verlauf extrem ungleichmäßig, weil er so gut wie immer von Strukturen sozialer Ungleichheit beeinflusst wird. In den Städten des frühneuzeitlichen Europas und des Osmanischen Reiches konnten die Reichen aus überfüllten Städten auf Landsitze flüchten, wo eine Ansteckung weniger wahrscheinlich war.
In den Pestjahren des frühneuzeitlichen Cambridge wurden die höchsten Sterbequoten aus den Vororten zwischen Jesus College und Barnwell gemeldet, wo College-Bedienstete und arme Arbeiter lebten. In New Orleans starben tendenziell neue Einwanderer, vor allem Iren und Deutsche, in großer Zahl am Gelbfieber, weil sie in billigen Zimmern in überfüllten Mietshäusern lebten, wo eine hohe Ansteckungsgefahr bestand.
Im kolonialen Amerika grassierten Seuchen am schnellsten unter Bevölkerungsgruppen, die durch Unterernährung bereits geschwächt waren. Im 18. Jahrhundert wiesen indigene Amerikaner eine erhöhte Anfälligkeit für Pocken auf, wie eine Kollegin mir sagte, weil sich ihre Ernährung durch die Zwangsumsiedlung verschlechtert hatte.
Heute gibt es in den Vereinigten Staaten und vielen anderen Ländern Anzeichen für große Unterschiede bei den Todeszahlen, die mit dem Einkommen und dem Niveau der Gesundheitsversorgung korrelieren. Selbst in den wohlhabendsten Teilen der Welt hat die Pandemie das soziale Bewusstsein geschärft. Pflegekräfte, Krankenschwestern, Sozialarbeiter, Sanitäter und die Fahrer der Lieferdienste rückten in den Fokus - Mitbürger, deren Tätigkeit in der Regel nicht gerade üppig entlohnt wird, deren Bedeutung uns aber schlagartig vor Augen geführt wurde. Menschen lernten ihre Nachbarn kennen, brachten Männern und Frauen aus Risikogruppen, die in ihren Wohnungen eingesperrt waren, Lebensmittel, Einkäufe und Medikamente. Viele Briten kamen aus ihren Häusern, um den Gesundheitsarbeitern zu applaudieren (zumindest bis die Regierung sie ausdrücklich dazu aufforderte, wonach die Begeisterung schlagartig abnahm).
Auch hier gibt es Parallelen zur Vergangenheit. Selbst bei Ausbrüchen der Beulenpest, einer erbarmungslosen und schrecklichen Seuche mit einer weit höheren Sterblichkeitsrate als Covid-19, bewiesen mittelalterliche englische Gemeinden ein außerordentlich hohes Maß an gesellschaftlicher Solidarität.
In Venedig und Florenz ergriffen die Behörden vielfältige Maßnahmen: die Zahlung von Urlaubsgeld, kostenlose Lebensmittellieferungen (samt einem Liter Wein täglich), Steuer und Mietstopps sowie Bemühungen, den Leuten wieder Arbeitsstellen zu vermitteln, sobald die Seuche vorüber war. Die Pockenepidemie im kolonialen Amerika brachte enorme pflegerische Heldentaten mit sich, in erster Linie von Frauen, die häufig die Kinder toter Nachbarn, Freunde und Verwandter aufnahmen und großzogen. Statt die Bande der Solidarität zu zerstören und für Anarchie zu sorgen, verstärkte die Begegnung mit epidemischen Krankheiten den sozialen Zusammenhalt und bestätigte moralische Standards.

Während des Lockdowns las ich zufällig Heinrich Heines "Französische Zustände", eine Reihe von Artikeln, die er während seines Aufenthalts in Paris 1832 geschrieben hat. Mitten in einem Beitrag vom April 1832 entdeckte ich die folgende Klammer, die einige Jahre später eingeschoben wurde:
"Ich wurde in dieser Arbeit [dem Schreiben] viel gestört, zumeist durch das grauenhafte Schreien meines Nachbars, welcher an der Cholera starb. Überhaupt muss ich bemerken, dass die damaligen Umstände auch auf die folgenden Blätter misslich eingewirkt; ich bin mir zwar nicht bewusst, die mindeste Unruhe empfunden zu haben, aber es ist doch sehr störsam [sic], wenn einem beständig das Sichelwetzen des Todes allzu vernehmbar ans Ohr klingt."
Heine hatte gesehen, wie Menschen den verstümmelten Leichnam eines Mannes durch die Straßen zerrten, den ein Mob gelyncht hatte, weil man eine Sub-stanz aus weißem Pulver bei ihm gefunden hatte. Man hatte es für einen die Cholera verbreitenden Giftstoff gehalten (in Wirklichkeit entpuppte sich das Pulver als Kampfer, von dem manche meinten, es schütze vor der Krankheit). Er hatte gesehen, wie weiße Säcke voller Leichen im weitläufigen Saal eines öffentlichen Gebäudes aufgestapelt wurden, und die "Leichenwächter" beim Zählen der Säcke beobachtet, als sie an die Totengräber übergeben wurden, um sie auf Wagen zu verladen. Er erinnerte sich, wie zwei kleine Jungen mit betrübten Gesichtern neben ihm standen und ihn fragten, in welchem Sack denn ihr Vater stecke. Ein Jahr danach waren das Leid und die Angst vergessen.
Die Choleramonate waren eine "Schreckenszeit" gewesen, weit furchtbarer als jeder politische Terror des Jahres 1793. Die Cholera war "ein verlarvter Henker, der mit einer unsichtbaren Guillotine ambulante durch Paris zog". Nichtsdestotrotz hatte die Seuche allem Anschein nach der frivolen Lebensfreude der Stadt keinen Abbruch getan.
Am Rand des Sichtfelds
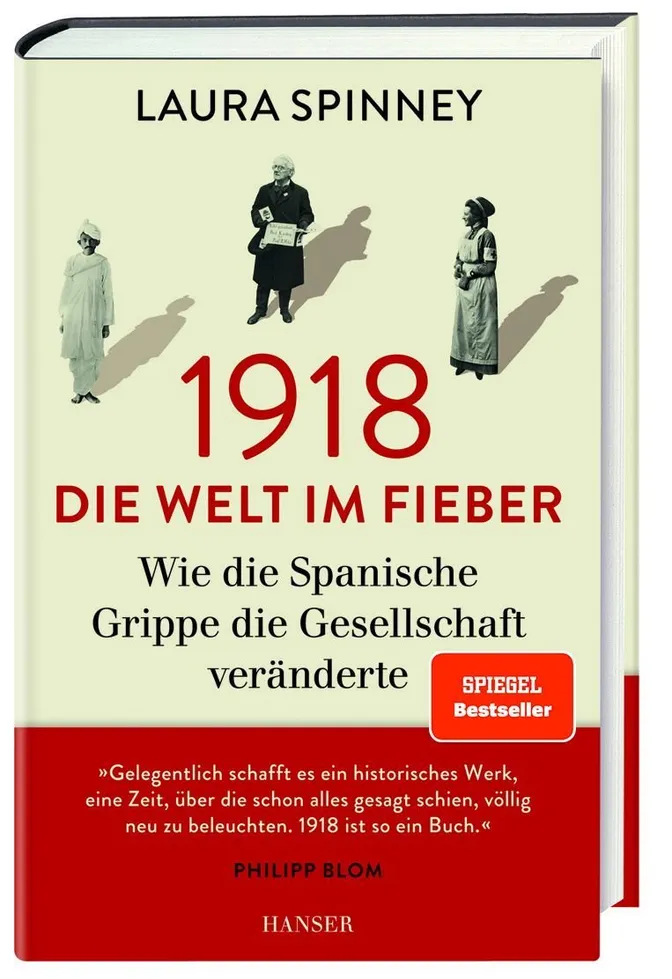
Ich begann über den Stellenwert epidemischer Katastrophen in der Geschichte nachzudenken. Es gibt unzählige hervorragende Studien über die Auswirkungen von Seuchen: Richard Evans’ Standardwerk "Tod in Hamburg" über die Choleraepidemien im 19. Jahrhundert; Laura Spinneys "1918 - Die Welt im Fieber" über die Spanische Grippe von 1918/19; und Kathryn Olivarius’ Studie über das Gelbfieber in New Orleans vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg, um nur ein paar zu nennen. Es war jedoch verblüffend, wie wenig Spuren selbst die furchtbarsten Begegnungen mit tödlichen Krankheitserregern in den großen historischen Darstellungen und im öffentlichen Gedächtnis hinterlassen hatten.
Einer meiner Gesprächspartner meinte, er habe sein ganzes Erwachsenenleben über den Einfluss des Krieges auf die amerikanische Regierungsarbeit nachgedacht, aber noch keine einzige Zeile über die Grippeepidemie 1918/19 geschrieben, durch die mehr Amerikaner als im Ersten Weltkrieg umkamen. Wie viele Amerikaner wissen heute noch, dass in den amerikanischen Revolutionskriegen mehr Landsleute an den Pocken starben als durch den bewaffneten Konflikt?
Offenbar ist das ein für die Neuere Geschichte und die Zeitgeschichte typisches Problem: Der Schwarze Tod zählt zu den zentralen Themen mittelalterlicher Studien, und auch Experten für die frühe Neuzeit sind sich der Bedeutung von Seuchen bewusst. Die Eroberung Amerikas durch die Spanier wäre, merkte einer meiner Gesprächspartner an, möglicherweise nicht so verlaufen, wenn die Konquistadoren nicht "unsichtbare Verbündete" in Gestalt von Seuchen gehabt hätten, die auf der Iberischen Halbinsel endemisch, aber in Mexiko und in den Andenregionen unbekannt waren. Deren Bewohner, die aus immunologischer Sicht diesen Erregern hilflos ausgeliefert waren, wurden durch sie so gut wie ausgerottet.
Erst in der Neuzeit wurden Seuchen offenbar an den Rand des Sichtfelds und der Sichtbarkeit gedrängt. Eine Kollegin vermutete, dass das mit Genderfragen zu tun haben könnte: Da Frauen bei Seuchenausbrüchen den Löwenanteil an der Pflege geschultert hätten, so argumentierte sie, habe das Thema bei männlichen Historikerkollegen prompt jede Anziehungskraft eingebüßt.

Angesichts des Umstands, dass die Grippeepidemie in vielen Schilderungen des US-amerikanischen Beitrags zum Ersten Weltkrieg so gut wie unsichtbar ist, behauptete ein anderer Kollege, eine Historiographie, die auf das Ringen und Schicksal der Nationalstaaten ausgerichtet sei, sei stärker an jenes Leiden und Opfer gewöhnt, das auf den Schlachtfeldern stattfinde, als an jenes, das sich in Krankenhäusern abspiele, wenn die Zahl der Todesopfer steige.
Und womöglich gibt es auch in der Natur einer Epidemie etwas, das sich unseren Bemühungen widersetzt, sie in eine große Darstellung einzubeziehen. Historiker und allgemein Menschen sind geradezu süchtig nach menschlicher Urheberschaft, sie lieben Geschichten, in denen Menschen einen Wandel bewirken oder auf ihn reagieren. Sie denken in langen Kausalketten. Zu einer Epidemie kommt es hingegen, wenn ein nichtmenschlicher Akteur ohne Vorwarnung unter der menschlichen Bevölkerung ausbricht. Ein auf Menschen ausgerichtetes Narrativ, deutete ein Kollege von mir an, werde niemals imstande sein, ein Phänomen wie Covid-19 vernünftig auszuloten, dessen lebenszerstörender Erreger die Grenze zwischen der tierischen und menschlichen Welt überschritt.
Absolut einzigartig
Was wir aus der Pandemie lernen werden, bleibt abzuwarten. Während ich diese Zeilen schreibe, ist noch nicht klar, wie schnell und wie umfassend sich die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt von dieser Krise erholen werden. Die Begegnung mit einer Pandemie ist nicht neu, neu sind jedoch die Maßnahmen, um ihre Verbreitung zu verhindern. Wie ein Podcast-Partner ganz richtig bemerkte, sind die Geschwindigkeit und das Ausmaß des wirtschaftlichen Stillstands absolut einzigartig. Die Krisen von 1929 und 2007/08 unterschieden sich voneinander, aber beide wurden von internen Fehlfunktionen des weltweiten Wirtschaftssystems ausgelöst.
Die pandemische Krise hingegen ist ein exogener Schock, ein rasches Einfrieren der realen Wirtschaft per Regierungsdekret. Die Geschwindigkeit des Handelns ist wichtig, weil sie zur Folge hatte, dass die beteiligten Akteure so gut wie keine Zeit hatten, ihr Verhalten an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Ob eine teilweise eingefrorene Weltwirtschaft wieder aufgetaut und wieder angekurbelt werden kann, wird sich erst zeigen. An diesem Punkt stand die Menschheit noch nie. (Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz.)
Christopher Clark, geboren 1960 in Sidney, lehrt als Professor für
Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine’s College in Cambridge.
Weltweit berühmt wurde er mit seinem Buch zur Entstehung des Ersten
Weltkriegs, "Die Schlafwandler" (2013). Nebenstehender Text ist ein Auszug aus dem Vorwort seines neuen Buches, "Gefangene der Zeit" (DVA, 336 Seiten, 26,80 Euro), das am 16. November erscheint und in dem
Clark in 13 Essays auf vielfältige Weise zeigt, wie sehr historische
Ereignisse und Taten, Vorstellungen von Macht und Herrschaft über die
Zeiten hinweg und bis heute fortwirken.
