Von Ovid bis Vico Torriani: Reflexionen über das Leben in pandemischen Zeiten und viralen Gesellschaften. Eine Bücher-Rundschau.
Eines der vielen Probleme dieser Pandemie ist, medial betrachtet, die Wiederkehr des Immergleichen: also der stets gleichen Meldungen, Verlaufskurven, Artikel und Bilder (etwa Teststäbchen in Nasenlöchern oder Impfungen an Oberarmen). Dazu gehören naturgemäß auch Sprachbilder, denn, wie Franz Schuh schreibt, Corona ist ja "nicht bloß ein Virus, sondern auch eine eigene Textgattung geworden". Oder wie Robert Misik Susan Sontag, die Ahnfrau der medizinischen Metaphorologie, paraphrasiert: "Krankheiten werden, kaum identifiziert, sofort erklärt, sie werden gedeutet, gleichsam mit Sprache infiziert wie die Zelle vom Virus."
Deutungslust
Dieser Vorgang der sprachlichen Infektion erfolgt ebenfalls überfallsartig und ubiquitär: Einer steckt sich beim anderen mit dessen Wortwahl an - und es entstehen metaphorische Cluster. Um eine Form von gedanklicher Mutation der ewiggleichen Stereotype und inflationären Gebrauchswörter bemühten sich daher alsbald sogenannte originelle Denker, also sprachauffällige Neuwortschöpfer. Und da waren die üblichen Verdächtigen rasch zur Stelle, also Philosophen wie Slavoj Žižek, Giorgio Agamben oder Peter Sloterdijk, die mit unterschiedlichem Temperament, aber ähnlich unverhohlener Deutungslust der ausbrechenden Pandemie ihre Interpretationen andichteten und überstülpten. Diese reichten vom Virus als Hegel’schem Weltgeist (bei Žižek) über eine Kritik des Ausnahmezustands (bei Agamben) bis zum Bild des Mitmenschen als "Umkehrbild des Vampirs" bei Sloterdijk: "... er saugt nicht ab, er flößt etwas ein: Der Nächste könnte unbewusst ein Virusträger sein."
Das Echo auf derlei Gedankensprünge und Wortmeldungen war in erster Linie mediale Häme: Dass den Philosophen außer Banalitäten erstaunlich wenig eingefallen sei, konstatierte die "Süddeutsche Zeitung". Und die "FAZ" bemängelte die komplette Abkehr der Denker vom Geschehen, ihre "Schiffbruch mit Zuschauer"-Perspektive - und ließ den deutschen Kulturwissenschafter Joseph Vogl über seine Kollegen und Konkurrenten herziehen, der meinte, es ginge ihnen lediglich "um den Gewinn eines hermeneutischen Vorsprungs gegenüber einer Wirklichkeit, die auf unbequeme Weise im Fluss ist".
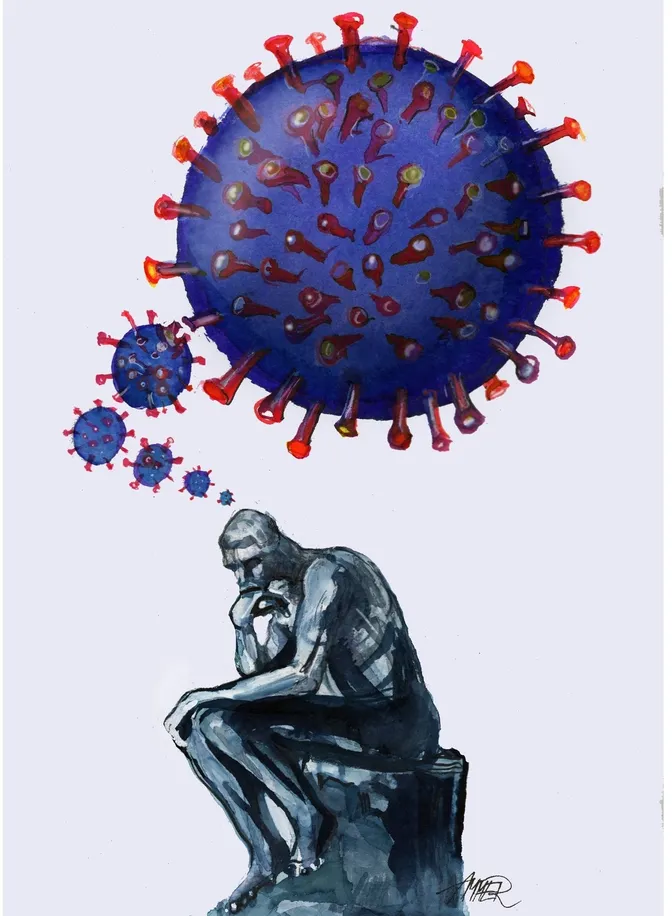
Abgesehen davon, dass Vogl sich mit solch einer Stellungnahme ebenfalls eine Art Vorsprung und Meta-Urteil sicherte und die zitierten Medien selbst wenig zu einer neuen Sichtweise und zu originellen Sprachforme(l)n beitrugen, war es wohl ein anderer Umstand, der rasch zum Verstummen der "Großintellektuellen" in Sachen Corona-Diskurs führte. Ich vermute, dass den bisherigen Querdenkern die neuen, auf andere Weise abseitig agierenden "Querdenker" buchstäblich in die Quere kamen. Mit diesen weniger originell als verschwörerisch und ideologisch auf gefährlichem Terrain argumentierenden Gruppierungen wollte man als hehrer Denker nichts zu tun haben, weshalb Vorsicht in der Wortwahl und Zurückhaltung bei unorthodoxen Gedanken geboten war (und ist).
Und noch etwas war und ist auffällig: Während es zu Beginn der Pandemie - wie dargelegt - fast nur Männer waren, die sich (vor)schnell zur allgemeinen Lage äußerten, einer Art von intellektueller "Ejaculatio praecox", sind es nunmehr, im metaphorischen Herbst der Pandemie (den wir in diesem Frühjahr hoffentlich erreicht haben), vorwiegend Frauen, die sich mehr oder weniger überzeugend, aber jedenfalls entschieden und bisweilen erfrischend forsch dem rein epidemiologischen Denken entgegenstellen, wie etwa die Soziologin Eva Illouz, die Politologin Ulrike Guerot, die Publizistin Thea Dorn oder die Psychotherapeutin Martina Leibovici-Mühlberger (die vor allem - auch mehrfach in dieser Zeitung - auf die psychosozialen Defizite von Kindern und Jugendlichen während der Lockdowns hinwies).
Steile & flache Thesen
Um sie alle soll es im Folgenden freilich nicht gehen, sondern um einige Bücher, die auf dem Feld der pandemischen Interpretationen, des Nachdenkens, Einfühlens und Innehaltens neue Vermessungen vorgenommen haben und erst kürzlich erschienen sind.
Wie etwa der Band "Nachdenken über Corona", der eine Reihe philosophischer Essays über die Pandemie und ihre Folgen versammelt. Er ist das Ergebnis eines Wettbewerbs, bei dem mehr als hundert Texte eingereicht wurden, von denen eine Fachjury neun für die Publikation auswählte und drei davon prämierte. Wie der Titel schon suggeriert, sollte dabei weniger die Originalität von Thesen als die Genauigkeit und Sorgfalt ihrer Darlegung im Vordergrund stehen. Denn, so dekretiert das Vorwort: "Wo Philosophie verblüffen will, verspielt sie ihre Stärken. Steile Thesen sind oft vor allem eines: falsch."
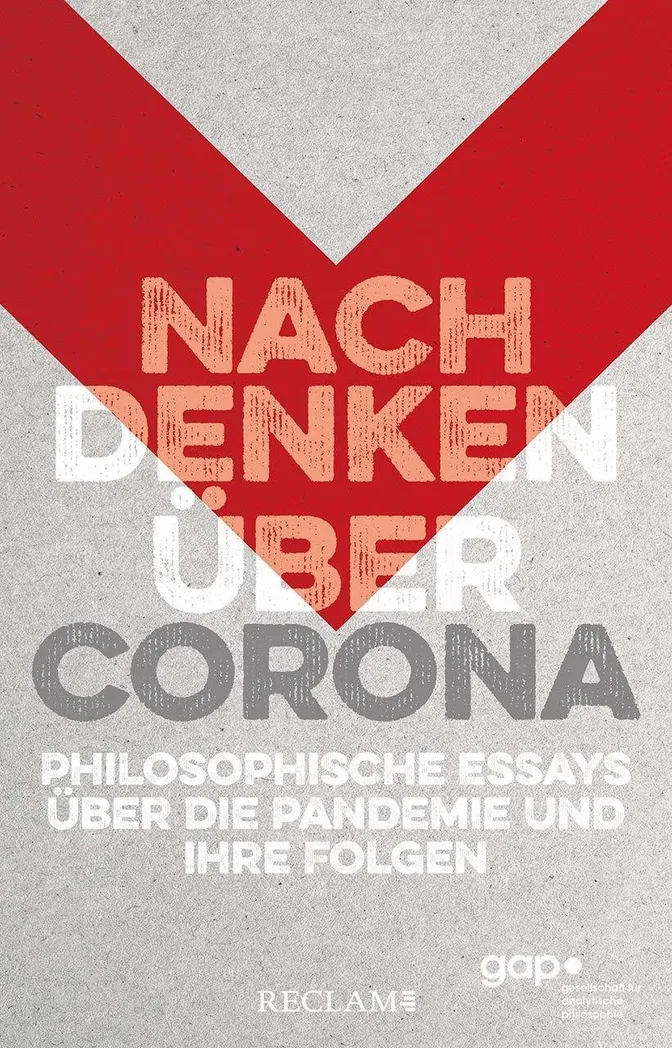
Das ist selbst eine steile These, die in diesem Band, der keinerlei steiles Gedankengefälle aufweist, zu einer anderen, flacheren These führt: Wo Philosophie zeigen will, wie sorgfältig und genau sie nachdenkt, wird sie vor allem eines: langweilig. Denn es ist schon von erstaunlicher Zähigkeit und Ödnis, mit welch angestrengter Seriosität hier die naheliegenden Fragen und Probleme der Corona-Zeit schulphilosophisch durchdekliniert werden. So braucht etwa der eingangs in dem Buch veröffentlichte "Siegertext" ("Vertrauen als politische Kategorie in Zeiten von Corona" von Christian Budnik) lange 13 Seiten, um vom Vertrauen, das dem Autor als überzogene personale Kategorie in pandemischen Zeiten erscheint, zur "Alternative der Verlässlichkeit" voranzuschreiten, die er als probatere und ernsthaftere Kategorie (an)empfiehlt. Ja eh, aber dafür bräuchte Peter Sloterdijk einen einzigen sprachlich pointierten Satz und keine ganze Abhandlung. Und alles wäre klarer, hell- und einsichtiger.
Linguistisches Depot
Nicht viel besser und einleuchtender wird es, wenn in einem Essay mit dem an sich sympathischen Titel "Lob der Vermutung" (von Emanuel Viebahn) verschiedene Arten der Krisenkommunikation zwischen Experten (wie etwa den Virologen Christian Drosten und Alexander Kekulé) mittels "Sprechakttheorien" durchgekaut werden, diesem aus dem Kulissendepot der pragmatischen US-Linguistik hervorgeholten Inventarium, das im Alltag relativ eindeutige Begriffe und Zuschreibungen auf wenig anschauliche Weise verkompliziert. Damit macht man in philosophischen Seminaren bis heute unzählige Meter, verschleppt Abhandlungen aber bis zur Unkenntlichkeit. Man gewinnt damit jedenfalls kaum neue Einsichten, auch nicht in die Dynamiken virologischer Expertengespräche, von denen man schon so genug hat, dass man sie nicht auch noch in akademischer Verkleidung nachgespielt sehen will.
"Graubrot" hat der Literaturkritiker Michael Maar, wenn auch in anderem Zusammenhang, diese Art von Fachsprache genannt, die - zumindest in stilistischer Hinsicht - nur schwer verdaulich ist.
Von anderer Backform und sprachlich-gedanklicher Verdaulichkeit ist da schon das Buch "Pantherzeit" der in Kroatien geborenen und in Berlin lebenden Schriftstellerin Marica Bodrožić. Es ist eine Reflexion ihrer inneren Einkehr, zu der sie - wie alle anderen auch - während des ersten Lockdowns gezwungen war. Der Titel bezieht sich darauf, dass die Autorin zwei Monate lang täglich um 20 Uhr auf ihren Balkon trat und das berühmte "Panther"-Gedicht von Rainer Maria Rilke ("... und hinter tausend Stäben keine Welt") rezitierte.
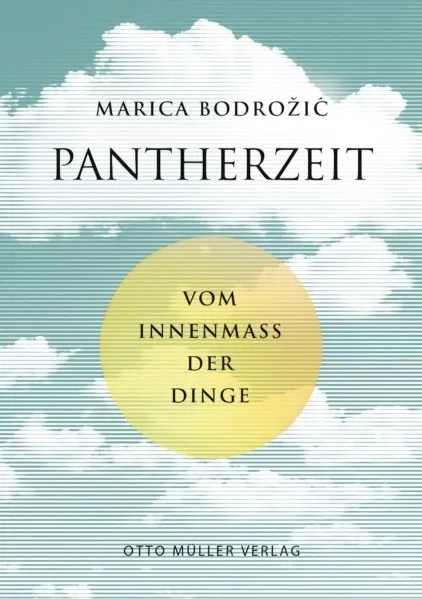
"Das Gedicht strukturiert meine Gedanken und lässt mich alles genau in Augenschein nehmen. Der Panther bin ich selbst. Ich umlauere meine Erkenntnisse, als müsste ich mich noch eine ganze Weile vor etwas schützen, das mich kennt, das aber ich nicht kennenlernen will..." Und noch einen weiteren literarischen Gewährsmann, aus noch weiterer Ferne, zitiert Bodrožić herbei, allerdings nicht auf den Balkon, sondern ins stille Kämmerlein: "Wir sind nun wie Ovid und doch anders als er in Verbannung. Unser Schwarzes Meer ist die dunkle kollektive Nacht, die uns kathartisch in die Verwandlungskräfte der Natur und in die Welt der Seele treibt."
Hier bemüht sich also jemand sichtbar, trotz Dunkelheit, um erhellende Vergleiche, um neue Sicht- und Sprechweisen. Das gelingt zum Teil gut, wenn die Autorin etwa über die - durch die Covid-Erkrankung besonders hervorgehobene - Bedeutung des Atems und die Beschaffenheit von untätigen Händen schreibt (die geschwollenen eigenen, und die sie unschuldig und weise führenden der kleinen Tochter). Auch konzise Erkenntnisse fallen ab: "Die Zeit beeilte sich nicht mit mir. Die Zeit ließ mir Zeit." Und historische Hinweise auf die 900 Tage der Blockade von Leningrad oder auf jene Eingeschlossenen, die 1.425 Tage lang die Belagerung von Sarajevo aushalten mussten, relativieren das aufkommende Selbstmitleid der heute relativ bequem in Selbstisolation Lebenden.
Von innen und außen
Doch dann, nach rund 120 von leider doppelt so vielen Seiten, geht auch dieser sensiblen, allem hinterherspürenden und -schreibenden Schriftstellerin der Atem aus, verliert ihr innerer Panther an Spannkraft. Und in der Folge wiederholen sich die immer wieder gleichen Bilder, Beschreibungen und überzogenen Hoffnungen (auf das Ende aller Lügen, der Ausbeutung und des Kapitalismus). Die vermeintlich neue Sprache ist dann zum Teil auch nur eine sehr alte - eine der Mysterien und Offenbarungen, von Teresa von Avila über Meister Eckhart bis zu C. G. Jung -, die Bodrožić herbeizitiert und mitunter unfreiwillig parodiert. Und gegen Ende hin wundert man sich, wie eine derart auf poetische und bisweilen mystische Konzentration Versessene derart schwatzhaft werden kann. Es mag schon sein, dass sie - wie sie an einer Stelle zugibt - nur im Schreiben alles andere rund um sich vergisst, sich also in eine imaginäre Sprachwelt rettet. Das ist gut für sie, aber weniger gut für Lesende, die sich in diesem Schwadronieren mehr verlieren als finden.
Da ist man mit dem neuen Buch von Robert Misik besser bedient. In "Die neue (Ab)Normalität" beschreibt der Wiener Journalist und Autor in ungezwungener Beiläufigkeit und mit doch großer Genauigkeit die Phänomene jenes gegenwärtigen Gesellschaftsexperiments, das "nur den Nachteil hat, dass wir in diesem Versuch die Beobachter und zugleich die Laborratten sind". Es ist also ein Bericht von innen und außen, daher durchaus abwechslungsreich und unterhaltsam, denn: "Auch die Katastrophe hat ihre Romantik und das Desaster ist für aufmerksame Beobachter Material(...) Deswegen müssen wir über unser Jahr in der Niemandsbucht dringend nachdenken. Aufschreiben, was da mit uns geschieht."

Und das tut Misik. Er ist ein bewährter sozialer Spurenleser, der - mit Foucault und Susan Sontag als soliden und verlässlichen Reisebegleitern - durch heutige Lagen und Situationen streift und wie im Vorbeigehen kluge Einsichten befördert. Manche sind so offenkundig, dass viele sie gar nicht mehr sehen (wollen). Wie etwa das Gerede von der wachsenden Solidarität in Zeiten von Corona, das Misik schlüssig entkräftet: "Aber Solidarität ist schwierig, wenn das Beste, was man für andere tun kann, daheimzubleiben ist und sich die Hände zu waschen, und wenn der Nächste potenziell ansteckend, also tödlich ist."
Solche großen, kleinen Wahrheiten sprießen in diesem Büchlein unspektakulär an vielen Stellen. Das beginnt schon bei der pandemischen Rede vom "Social Distancing" - "dieses eigentümliche Wort der Stunde, ein Oxymoron eigentlich, ist auf dumme Weise falsch. Wir halten ,physische Distanz‘ und versuchen, so gut das geht, sozial zu kuscheln."
Oder: "Leider ist unser ,Ausnahmezustand‘ für viele noch langweiliger als die Normalität." Oder das "Präventionsparadox": "Wenn richtige Maßnahmen wirken, erwecken sie den Eindruck, unnötig gewesen zu sein." Und, als Letztes: "Lockdown, Lockerung, Lockdown, das erinnert frappierend an die katholische Abfolge von Sünde und Buße." Alles richtig gesehen, erkannt und auf den Punkt gebracht (wie etwa auch der treffende Ausdruck vom "buchstäblichen Still-Leben").

Lediglich in seine doch sehr sozialdemokratische Vision von einer gerechteren (Finanz-)Welt nach Corona und die Aussicht auf neue "goldene Zwanzigerjahre" mit Dauer-Party muss man Misik nicht zwangsläufig folgen. Es könnte auch anders kommen.
Falls die Party aber doch beginnt, sollte man auf Franz Schuh hören, der in seinem neuen Buch, "Lachen und Sterben", nicht nur den pädagogischen Vorschlag macht, "Corona als Textsorte in die Maturaprüfung aufzunehmen", sondern auch genaue Vorstellungen davon hat, wie das Ganze klingen soll: ",Corona, Corona, Corona‘ - das muss man singen im Stile von Vico Torriani, einem Schweizer, der auf Italianità machte und dessen Italienisch, obwohl es perfekt war, stets nach deutschem Touristen in Caorle klang."
Literatur:
Georg Keil/Romy Jaster (Hrsg.)
Nachdenken über Corona
Philosophische Essays über die Pandemie und ihre Folgen. Reclam, Ditzlingen 2021, 135 Seiten, 12,- Euro.
Marica Bodrožić
Pantherzeit
Vom Innenmaß der Dinge. Otto Müller Verlag, Salzburg 2021, 262 Seiten, 22,- Euro.
Robert Misik
Die neue (Ab)Normalität
Unser verrücktes Leben in der pandemischen Gesellschaft. Picus, Wien 2021, 157 Seiten, 16,- Euro.
Franz Schuh
Lachen und Sterben
Paul Zsolnay Verlag, Wien 2021, 334 Seiten, 26,80 Euro.
