Zum Tod des peruanischen Soziologen Aníbal Quijano, der im Diskurs über kulturelle Abhängigkeiten ein zentraler Vermittler war.

In Lateinamerika ist der Kolonialismus lange vorbei. Die meisten Länder des Subkontinents erkämpften in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre Unabhängigkeit - zumindest in adminis-trativer Hinsicht. Viele Effekte der kolonialen Herrschaft allerdings leben fort, auch lange nach Beendigung der militärischen Besatzung. Zu den augenfälligsten dieser Spätfolgen gehört wohl die ethnische Einteilung der Bevölkerungen: Kategorien wie weiß, mestizisch/kreolisch und indigen sind koloniale Erfindungen. Die ethnische Einteilung prägt in allen lateinamerikanischen Ländern auch die Sozialstruktur. Zwar gibt es inzwischen indigene Präsidenten wie Evo Morales in Bolivien, in der Regel aber sind die Indigenen arm - und die Weißen reich.
Reichtumsverteilung und ethnische Einteilung sind zwei Ebenen, die zeigen, dass die Unabhängigkeit offenbar noch nicht vollendet ist. Abhängigkeiten bestehen weiterhin, ökonomischer ebenso wie kultureller Art. Die ökonomische Abhängigkeit der Länder Lateinamerikas von europäischen Metropolen war das zentrale Thema der Dependenztheorien der 1960er und 70er Jahre.
Die kulturellen Abhängigkeiten werden in den letzten Jahren verstärkt von theoretischen Strömungen in den Blick genommen, die sich unter dem Label dekolonialistische Theorie versammeln. Ein zentraler Vermittler zwischen beiden Strömungen, zwischen Dependenz- und dekolonialistischer Theorie, ist der peruanische Soziologe Aníbal Quijano.
Lebendige Theorie
Die fortlaufenden Effekte des Kolonialismus nach Beendigung der politischen und militärischen Herrschaft nannte er die "Kolonialität der Macht". Mit diesem Konzept konnten die verschiedenen Formen von Unterordnung und Abhängigkeit in den Blick genommen werden. Quijano, der Gastprofessor und Ehrendoktor an Universitäten in verschiedenen Ländern (Peru, Venezuela, Mexiko, Costa Rica) war, verstarb am 31. Mai 2018 im Alter von 90 Jahren. Sein theoretischer Ansatz aber ist so lebendig, wie Theorie es eben sein kann.
Allein die Titel der wichtigsten seiner Veröffentlichungen wie etwa "Crisis imperialista y clase obrera en América Latina" (1974) ("Krise des Imperialismus und Arbeiterklasse in Lateinamerika") und "Imperialismo, clases sociales y estado en el Perú, 1890-1930: El Perú en la crisis de los años 30" (1978) ("Imperialismus, soziale Klassen und Staat in Peru 1890- 1930 . . .") weisen sein Denken als eines aus, das tief in der marxistischen Theorie verankert ist.
Das änderte sich auch nicht mit den Schwerpunktverlagerungen, die Quijanos Arbeiten in den 1980er und 1990er Jahren erfuhren. Anders als anderen dekolonialististischen Theoretikern ging es Quijano nicht um eine Abgrenzung vom Marxismus, auch als er sich Fragen der Moderne, des
Eurozentrismus und der Globalisierung zuwandte. Es ging ihm immer auch um eine Erneuerung und Aktualisierung marxistischer Grundannahmen. Eine solche Erneuerung bestand etwa in Form einer Revision zentraler Begriffe wie jenem der Arbeit.
Quijano knüpft mit seiner Diskussion des Arbeitsbegriffes an eine Debatte an, die sowohl auf theoretischer wie auch auf politischer Ebene von José Carlos Mariátegui (1894-1930) angestoßen worden war. Der ebenfalls peruanische Marxist und Mitbegründer der Sozialistischen Partei Perus (1928) hatte Ende der 1920er Jahre auf die besondere Situa-tion Lateinamerikas, insbesondere im Hinblick auf die ökonomische Rückständigkeit der ländlichen Regionen, hingewiesen.
Klasse & Klassifizierung
Er fragte sich nach den Konsequenzen, die daraus für eine marxistische Gesellschaftsanalyse - und selbstverständlich auch für linke Politik - zu ziehen seien. Mariátegui stellte mit seiner Aussage, dass 90 Prozent der Indigenen in Lateinamerika nicht Proletarier, sondern Leibeigene seien, nicht nur die zentrale Fokussierung marxistischer Strategie auf das Industrieproletariat in Frage. Er machte darüber hinaus schon auf die enorme Bedeutung ethnifizierender und rassialisierender Zuschreibungen aufmerksam, also auf die Einteilung von Menschen in Ethnien und "Rassen".
Quijano greift diese Frage nach der Rolle des Subjekts der Arbeit auf. Er beantwortet sie mit einem Modell rassialisierter Klassifizierung, die unmittelbar mit dem (kapitalistischen) Produktionsprozess zusammenhängt. Die Zugehörigkeit zu einer Klasse leitet sich laut Quijano nicht automatisch aus dem Produktionsprozess oder aus gesellschaftlichen Strukturen ab. Sie ist stattdessen ein Effekt sozialer Kämpfe. Erst in der Auseinandersetzung um die Kon-trolle der Arbeit, so Quijano, wird eine solche Zugehörigkeit geschaffen. Im Kontext des Kolonialismus war ein Instrument dieser Kontrollkämpfe die ethnische Einteilung der Bevölkerung. Eine Kategorie wie "Rasse" im modernen Sinne hatte vor der Kolonisierung Amerikas nicht existiert.
Auf ihr gegründete soziale Beziehungen haben neue Identitäten geschaffen - Indigene, Schwarze, Mestizen u. a. - und bestehende umdefiniert. Diese wiederum wurden zur Grundlage einer neuen Organisation der Arbeit, die auf der permanenten Instituierung von Überlegenheit und Minderwertigkeit beruht.
Die Kategorie "Indio" schuf eine vermeintliche Minderwertigkeit, die das Schuften in den Silberminen legitim erscheinen ließ. "Die neuen historischen Identitäten, die um die Idee der Rasse herum in der neuen globalen Struktur der Kontrolle der Arbeit produziert wurden", schreibt Quijano, "waren mit sozialen Rollen und geohistorischen Orten verknüpft".
Tiefgehend abhängig
Die koloniale Organisation der Arbeit führte nicht nur zu einer ethnischen Spaltung der Arbeiter und zu unterschiedlichen Formen von Ausbeutung. Sie durchzog - und durchzieht bis heute - den gesamten sozialen Raum. Sie führt zur institutionellen wie alltäglichen Einteilung von Menschen in ethnische Kategorien. Sie macht aber auch vor anderen Einteilungen nicht halt: Was eigen und was fremd, was Innen und was Außen, was gut und was schlecht ist, all diese Wertungen sind von der Kolonialität der Macht durchzogen.
Die Kolonisierung, so Quijano, prägt also auch langfristig die kognitiven Perspektiven "der Produktionsweisen und der Art und Weise, materiellen oder intersubjektiven Erfahrungen Sinn zu verleihen, der Vorstellungswelt (imaginario), des Universums intersubjektiver Beziehungen in der Welt, kurz der Kultur". Die Abhängigkeit reicht also wesentlich tiefer, als ein auf ökonomische Verhältnisse beschränkter Blick es ermessen kann. Sie ist in die Körper und Denkweisen eingelassen.
Dass es bei den Folgen des Kolonialismus auch um Fragen des Sinns und der Erkenntnis geht, griff später der dekolonialistische Theoretiker Walter D. Mignolo auf. Die Kolonialität der Macht sei ein "aus Glaubenssätzen gesponnenes Netz, vor dessen Hintergrund gehandelt und Handlung rationalisiert wird", schreibt Mignolo in Anlehnung an Aníbal Quijano. Dieser kollektive Glauben umfasst letztlich jede Art von Wahrnehmen, Begreifen und Empfinden.
Die Dekolonisierung erscheint damit nicht nur als unabgeschlossenes, sondern als extrem umfassendes Projekt. Mignolo plädiert schließlich für eine "Entkoppelung" des dekolonialen vom "westlichen" Denken. Eine Schlussfolgerung allerdings, die der dialektisch denkende Quijano sicherlich nicht gezogen hätte. Eine Loslösung vom "westlichen Denken", zu dem zweifelsohne auch das von Marx gehört, wäre ihm unsinnig erschienen - es taucht als Forderung in seinen Schriften nicht auf. Ihm ging es um die Analyse und damit auch um die Demontage der Kolonialität der Macht.
Vergesellschaftung
Dass er dabei zuweilen nicht weit genug ging, wurde ebenfalls angemerkt. So hatte etwa die feministische Philosophin María Lugones Quijanos Konzeption von Geschlecht und Sexualität kritisiert. Auch Lugones betonte zwar, wie wichtig Quijanos Konzept der Klassifikation für ein Verständnis des globalen Kapitalismus sei. Aber, wandte sie ein, die Klassifikation betreffe keineswegs bloß "clasificación racial".
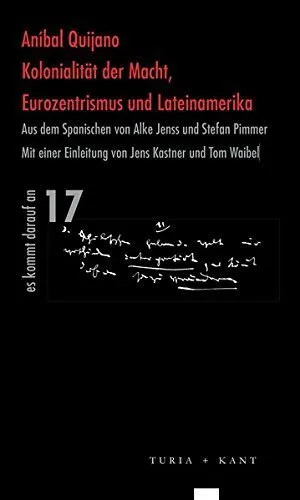
Auch die Naturalisierung der sexuellen Differenzen sei ein Produkt der modernen Wissenschaften, so wie Quijano es für die Naturalisierung der rassialisierten Zuschreibungen aufgezeigt habe. Für Quijano selbst allerdings ist, wie Lugones kritisch anmerkt, Geschlecht/Sexualität ("el sexo") "unbestreitbar biologisch". Damit fiel er hinter die Sichtweisen zurück, die feministische Theorie in den letzten Jahrzehnten etabliert hatte. Nämlich auch Geschlecht als machtvoll hergestelltes - wenngleich sehr wirksames - soziales Konstrukt zu betrachten.
Der Kombination feministischer Erkenntnisse mit Quijanos Ansatz steht prinzipiell allerdings nichts im Wege. In seinen politischen Anliegen war er keinesfalls auf die Klassenfrage und ethnische Differenzen festgelegt. Sein Modell gesellschaftlicher Transformation jedenfalls ging über bürgerlich-demokratische und staatssozialistische Vorstellungen deutlich hinaus. Es ging ihm, wie er im zuletzt auf Deutsch erschienen Buch "Kolonialität der Macht, Eurozentrismus und Lateinamerika" (Turia + Kant, Wien/Berlin 2016) fast trotzig schreibt, seit einem Aufsatz über Sozialismus aus dem Jahre 1972 um die "Vergesellschaftung der Macht".
Jens Kastner, geboren 1970, Soziologe und Kunsthistoriker, lebt als freier Autor und Dozent in Wien.