Der Mathematiker Jonathan Farley, der zwei Jahre an der Universität Linz tätig war, erklärt, wie man mathematische Methoden in der Terrorismus-Bekämpfung einsetzt und berichtet über seine Probleme mit dem Ku-Klux-Klan.
Wiener Zeitung: Herr Dr. Farley, Sie sind Mathematiker und beschäftigen sich unter anderem mit Terrorismusbekämpfung. Was kann man als Mathematiker gegen Terrorismus tun? Jonathan Farley: Ich entwerfe Modelle für Terrorzellen und versuche, den typischen Aufbau solcher Zellen in Form von "Graphen" zu dokumentieren. Sie zeigen, dass es Beziehungen zwischen einzelnen Punkten gibt. In der Praxis könnte das etwa bedeuten, dass zwei Individuen direkt miteinander kommunizieren. Die entscheidende Frage dabei ist: Wie viele solcher Punkte muss man entfernen, um ein terroristisches Netzwerk zu zerstören oder zumindest die Verbindungen zu unterbrechen? Ursprünglich bemühte man sich lediglich darum, Terrorzellen zu sprengen, ohne deren Strukturen zu kennen. Aber gerade diese Strukturen können uns wertvolle Informationen geben.
In der mathematischen Theorie nennt man das "partially ordered sets", partiell geordnete Mengen. In terroristischen Zellen gibt einer die Befehle - und andere führen sie aus, und das beeinflusst meine Vorstellung davon, wie man die Zelle zerstören kann. Noch interessanter finde ich die Frage, wie die perfekte terroristische Zelle strukturiert ist, vor allem jene, die weiter besteht, obwohl man einige ihrer Mitglieder, mehr oder weniger zufällig, bereits gefasst hat. Das könnte der Strafverfolgung helfen, die in der Regel nichts über die Struktur solcher Zellen weiß.
Auch bei der Grenzsicherung, die in den USA eine besondere Rolle spielt, kann solches Wissen nützlich sein. Wer illegal über eine Grenze kommen will, wird natürlich eine Route wählen, von der er sich den größten Erfolg verspricht. Das beruht auf mathematischer Psychologie, die man "reflexive control" nennt.
Allerdings meinen manche Kritiker, dass das Wissen um die Terrorzellen den Terroristen selbst mehr nützt als denen, die sie bekämpfen - und ich habe leider kein wirklich gutes Argument gegen diese Ansicht.
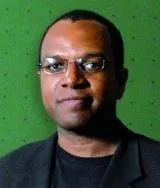
Wie lässt sich eine Terrorzelle charakterisieren? Wie entsteht sie und warum kann sie so schlagkräftig sein?
Es kommt darauf an, wie man sie darstellt. Ich gehe am liebsten von einer möglichst einfachen Definition aus, nämlich vom erwähnten "partially ordered set". Ich arbeite mit Leuten zusammen, die zwar über Terrorzellen Bescheid wissen, aber wenig Ahnung von Mathematik haben, und ich kann ihnen auf meine Weise helfen, ihre Arbeit besser zu machen. Diese Experten haben sich meiner Arbeit bedient, was mich sehr freut. Ich habe zum Beispiel mit der US-Air-Force-Academy zusammengearbeitet, und das "Pacific Northwest National Laboratory" hat mir sogar einen Job angeboten, den Kontakt aber dann abgebrochen, als ich den Verantwortlichen von den Angriffen aus dem Umkreis des Ku-Klux-Klan gegen mich berichtete.
In Jamaica hatte ich ein Treffen mit dem Minister für nationale Sicherheit. Von ihm habe ich von einem Polizeibeamten erfahren, der meine Ideen anwandte, um ein Drogen-und-Waffen-Schmuggler-Netzwerk aufzudecken. Weitere Theorien kann man in dem Buch "Mathematical Methods in Counterterrorism" nachlesen, das ich mitherausgegeben habe.
Darüber hinaus organisiere ich gemeinsam mit Kollegen nahezu jedes Jahr eine Konferenz zu diesem Thema. Meine Ideen werden also wahrgenommen, bekommen aber nicht immer die Unterstützung, die ich mir wünsche.
Woran liegt das?
Ein Grund dafür liegt sicher darin, dass ich Afro-Amerikaner bin. Wie erwähnt, haben mich Anhänger des Ku-Klux-Klan angegriffen, noch bevor ich mich mit Terrorismusbekämpfung auseinander setzte. Ich war mehr oder weniger gezwungen, aus Tennessee zu flüchten. Es gab Todesdrohungen gegen mich und andere Einschüchterungsversuche. In den Vereinigten Staaten war ich Ziel von Terroristen, die meinen Ruf zu zerstören versuchten, was die erwähnte Zurückhaltung zur Folge hat.
Sie haben zwei Jahre lang am Institut für Algebra der Universität Linz gearbeitet. Welche Ziele hatten Sie sich für Ihre Forschung gesetzt?
Ich habe in Linz meine Untersuchungen in der Verbandstheorie fortgesetzt, mich aber auch mit Terrorismusbekämpfung beschäftigt. Vor kurzem habe ich an einem kanadischen Projekt teilgenommen, das sich auch mit sozialen Netzwerken auseinandergesetzt hat. Von hier aus gehe ich an die University of Maine.
Gehen Sie mit gemischten Gefühlen zurück in die USA?
Ja, weil ich das Leben hier sehr gemocht habe und weil ich weiß, was mich erwartet: Wenn ich in den USA mein Wissen anbiete, errege ich ironischerweise Sorge und Angst, außer bei Leuten, die ich seit vielen Jahren kenne. Um ein Beispiel zu nennen: Im Jahr 2005 war ich zum Essen bei der österreichischen Botschafterin in den Vereinigten Staaten eingeladen. Dort traf ich den Vorstand der "Behavioral and Social Sciences Division" der amerikanischen Akademie. Er fragte mich, wie man mathematische Psychologie im Kampf gegen den Terrorismus einsetzen könne. Ich erklärte es ihm. Damals war ich an der Stanford University tätig, und ich lud ihn zu einem Treffen nach Stanford ein.
Nach einer Woche schickte er mir ein Mail mit einem Link zu einem Artikel, den ich für den britischen "Guardian" über den Kampf gegen den Terrorismus geschrieben hatte. Darin beschrieb ich auch den Rassismus in den Vereinigten Staaten. Der Vorstand fragte mich also, ob ich der Autor dieses Artikels sei. Er setzte mehrere Fragezeichen, um seine Überraschung über den Inhalt des Artikels auszudrücken. Da ich aber Politik nicht mit akademischer Arbeit vermengen wollte, machte ich einen Witz und sagte: Den hat mein Doppelgänger geschrieben. Ich hörte nie wieder von dem Mann, und das Treffen fand nie statt. So etwas gibt mir zu denken. Auch deshalb gehe ich mit gemischten Gefühlen zurück.
Welche Pläne haben Sie an der University of Maine?
Ich möchte meine Bemühungen um die Einrichtung eines Instituts für mathematische Methoden der Terrorismusbekämpfung fortsetzen. Das hatte ich bereits 2003 in den USA vorgeschlagen, in Österreich 2005, allerdings funktioniert das aufgrund von Österreichs Neutralität hier nicht. Im vergangenen Jahr wurde hingegen in Dänemark ein "Counterterrorism Research Lab" eröffnet. Ich war einer der Eröffnungredner.
Ebenfalls vergangenes Jahr bekam das "International Institute for Applied Systems Analysis" in Laxenburg einen neuen Direktor, Detlof von Winterfeldt, der früher ein Forschungsinstitut für Terrorismusbekämpfung in Los Angeles geleitet hat. Es gibt also ein Interesse an mathematischen Methoden in der Terrorismusbekämpfung, auch in Österreich.
Apropos Netzwerke: Inwieweit und auf welche Art nutzen Terroristenzellen das Internet?
Natürlich verwenden Terroristen das Internet. Auf einer Konferenz in Kanada hat ein Forscher über seine Erfahrungen mit Terroristen-Websites berichtet und versucht, sie zu kategorisieren. Der Risikomathematiker Gordon Woo, der in London arbeitet, hat vorgeschlagen, Websites und deren Links auf andere Websites zu untersuchen, um aufgrund der zahlreichen Links feststellen zu können, welche die wichtigsten Seiten im Netz sind. So könnte die Exekutive herausfinden, wer diese Websites betreibt.
Terroristisch-rassistische Gruppen in den USA, wie "The League of the South" oder "The Sons of Confederate Veterans", verwenden das Internet recht intensiv. In einem ihrer Newsletter hat die "Confederate Society of America" etwa angekündigt, gegen alle vorzugehen, die nicht ihre Meinung vertreten. In einem Kapitel seines medienkritischen Buches "Hot, Fat and Clouded. The Amazing and Amusing Failures of America´s Chattering Class" hat Barrett Brown über jenen Terrorismus berichtet, den auch ich selbst erlebt habe: Robert Stacy McCain, Redakteur der "Washington Times", so Barrett Brown, hätte unter einem Pseudonym für die Vorherrschaft der Weißen plädiert. Auch Leute in prominenten Positionen gehören solchen Organisationen an: US-Senatoren etwa, die beim "Council of Conservative Citizens" sprechen. In deren Newsletter wurde einmal dazu aufgerufen, eine Meute hinter mir her zu hetzen. Sie arbeiten mit Einschüchterung und Mord-Drohungen.
Welche geografischen Unterschiede im Terrorismus haben Sie eigentlich wahrgenommen? Was unterscheidet den Terrorismus in den USA von jenem in Europa?
Ein Unterschied ist, dass sich diese Gruppen in den USA immer wieder durchsetzen. Ich hatte eine unbefristete Stelle an der Vanderbilt University in Nashville, die ich aufgeben musste. Obwohl ich also einiges zur Terrorismusbekämpfung in den USA beitragen hätte können, ist man mir dort aus dem Weg gegangen. Außerhalb der USA habe ich keine persönlichen Erfahrungen mit dem Terrorismus gemacht.
Was bedeutet für Sie der 11. September 2001 heute?
Nichts anderes, als was er mir immer bedeutet hat: Ich bin ein Amerikaner, der von Unter stützern des Ku-Klux-Klan und rassistischen Gruppen angegriffen wurde. Der 11. September hat mich nicht überrascht. Aber ich will keine Tränen über den 11. September vergießen, solange niemand Tränen über Tulsa, Oklahoma, weint, als die weiße Mehrheit der Stadt die schwarze Minderheit nur deshalb eliminierte, weil er wirtschaftlich erfolgreich war.
Warum interessieren Sie sich überhaupt für den Terrorismus?
Ich musste, wie gesagt, aus Tennessee flüchten, weil es rassistischen Gruppen gelungen war, mich zu verleumden, was übrigens bis in die Gegenwart anhält. Ich mag den Ku-Klux-Klan nicht und habe das auch öffentlich gesagt. Als in Nashville eine aus öffentlichen Geldern finanzierte Statue zu Ehren des Klan-Gründers errichtet wurde, setzte ich mich für deren Entfernung ein. Man warf mir daraufhin vor, weiße Menschen zu hassen, was natürlich nicht stimmt. Es wurde behauptet, ich würde einen Genozid gegen weiße Menschen fordern, ich wäre Kommunist - solche Dinge wurden über mich geschrieben.
Ich dachte fatalerweise, dass ich den Gegenbeweis antreten und etwas tun müsste, um meine Reputation wiederherzustellen. Und weil man in den USA Geld mag, gründete ich ein Unternehmen namens "Phoenix Mathematics", dessen Aufgabe darin bestehen sollte, mathematische Lösungen zur Stärkung der inneren Sicherheit zu liefern. Ich dachte, dass ich dafür öffentliche Förderungen bekommen könnte und damit nicht mehr von Universitäten abhängig wäre. Phoenix Mathematics war aber nicht so erfolgreich, wie ich es mir erhofft hatte.
Während Ihres Aufenthalts in Österreich haben Sie sich wahrscheinlich eine Meinung über das hiesige Universitätssystem oder die österreichische Bildungspolitik gemacht. Was denken Sie darüber?
In den Vereinigten Staaten gibt es keinen freien Universitätszugang, das ist wohl der größte Unterschied. So betrachtet, ist das österreichische Universitätssystem besser als jenes in den USA. In Harvard zahlt man 50.000 Dollar im Jahr, um studieren zu können. Abgesehen davon, habe ich keine tiefschürfenden Unterschiede festgestellt. In England beispielsweise ist man, wie ich meine, den falschen Weg gegangen, als man versuchte, die Studiengebühren anzuheben, um mehr junge Menschen zu einem Studium zu bewegen. Die Folge ist: Ein junger Mensch in England, der sein Studium abschließt, hat 20.000 Pfund Schulden.
Angenommen, Sie würden nochmal auf die Welt kommen: Möchten Sie wieder Mathematiker werden?
Ich liebe die Mathematik, und selbst wenn ich Rechtsanwalt wäre, würde ich mich mit mathematischen Problemen beschäftigen. Mathematik ist das Einzige, was mich rundum glücklich macht. Es muss nicht unbedingt Mathematik und Terrorismusbekämpfung sein, auch wenn dieser Zusammenhang in meinem Fall autobiografisch begründet ist. Trotzdem setze ich meine Bemühungen fort, eine perfekte terroristische Zelle zu beschreiben, auch wenn die USA im Moment kein Interesse daran zeigen. Andererseits darf sich dann aber keiner darüber beschweren, dass meine Arbeit angeblich den Terroristen in die Hände spielt.
Zur PersonJonathan David Farley, geboren 1970 in Rochester, NY, hat eine brillante Karriere als Mathematiker gemacht: Er war Gastprofessor für Mathematik am California Institute of Technology (Caltech) und am Massachusetts Institute of Technology (MIT), Science Fellow am Center for International Security and Cooperation der Stanford University, und bis vor kurzem Forschungsstipendiat an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Das Wissenschaftsmagazin "Seed" reihte Farley unter die "15 wichtigsten Menschen, die das globale Gespräch über Wissenschaft im Jahr 2005 wesentlich mit geprägt haben". 2004 wurde er von der Harvard Foundation als "Distinguished Scientist of the Year" ausgezeichnet.
Farleys Spezialgebiet ist die Verbandstheorie. Zu seinen wichtigsten Beiträgen auf diesem Gebiet zählt die Lösung eines mathematischen Problems, das der MIT-Professor Richard Stanley 1981 formuliert hatte und das ungelöst geblieben war, bis es Farley gelang, eine Bijektion zu konstruieren, die zeigt, dass der h-Vektor einer natürlich gelabelten endlichen geordneten Menge mit Rangfunktion symmetrisch ist.
Farley hat auch regelmäßig zu politischen Fragen Stellung genommen, was nicht folgelos geblieben ist: 2003 musste er seine Stelle an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee, aufgrund von Todesdrohungen aus dem Umkreis des Ku-Klux-Klan aufgeben. Neben den rein fachlichen Fragestellungen arbeitet der Mathematiker daran, mathematische Methoden sinnvoll bei der Terrorismus-Bekämpfung einzusetzen.
Zurzeit ist Jonathan Farley Außerordentlicher Professor für Informatik an der University of Maine. Diese auf ein Jahr befristete Stelle hat er aufgrund seiner Bekanntschaft mit dem dortigen Institutsleiter bekommen. Er geht aber davon aus, dass er keine weiteren Stellenangebote in den USA erhalten wird. Deshalb lernt er nun Deutsch und hofft, nach Österreich zurückkehren zu können.
Ernst Grabovszki, geboren 1970, arbeitet in einem Wissenschaftsverlag und ist Lehrbeauftragter am Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft der Universität Wien.