Der Wiener Schriftsteller Daniel Glattauer über seinen Weg zum internationalen Bestseller-Autor, sein sportliches Interesse an Verkaufszahlen, das neue Buch über seinen Neffen Theo - und warum ihn sein Status als "Frauenversteher" ärgert.
"Wiener Zeitung": Herr Glattauer, beginnen wir mit einer auf die Literatur bezogenen Variante der beliebtesten und dümmsten Sportreporterfragen: Wie fühlt man sich als Bestsellerautor? Daniel Glattauer: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, man gewöhnt sich an angenehme Zustände ja sehr schnell. Und meint dann, es wäre immer schon so gewesen. Der Erfolg kam bei mir allerdings nicht über Nacht, sondern hat sich sozusagen eingeschlichen und wurde von Buch zu Buch größer. Ich hatte also genügend Zeit, mich darauf einzustellen. Das schützt vor Größenwahn. Aber es ist natürlich schon ein gutes Gefühl, erfolgreich zu sein und eine so große Leserschaft zu haben.
Verfolgen Sie die Verkaufszahlen Ihrer Bücher mit einem gewissen sportlichen wie auch finanziellen Interesse?
Ja, ich gebe zu, ich verfolge sie so regelmäßig und analytisch wie Fußballtabellen. Das ist das Spannende an Teil zwei der schriftstellerischen Tätigkeit: In Teil eins schreibt man das Buch, bei Teil zwei entlässt man es auf den Markt und beobachtet, wie es sich dort schlägt. Ich sehe das durchaus als sportlichen Wettkampf.
Verändert sich das Schreiben, wenn statt ein paar tausend Lesern ein Millionenpublikum auf neue Bücher wartet?
Ich glaube nicht, dass sich meine Art des Schreibens dadurch verändert hat. Ich weiß heute nicht besser als früher, wie man schreiben muss, um erfolgreich zu sein. Gäbe es dafür eine Regel, hätten wir nur noch Bestseller. Einmal klappt´s, dann wieder nicht. Man weiß das nie so genau. Bei mir gibt es, selbst wenn es um ernste Themen geht, immer ein Augenzwinkern, eine heitere Note, und das wird auch in Zukunft so sein. Es hat allerdings, unabhängig vom Erfolg, schon eine Entwicklung gegeben, die mir selbst auffällt: Ich schreibe nicht mehr gar so wortverspielt wie früher. Eventuell habe ich mich vom Unterhaltungsschreiber zum Beziehungsschriftsteller gemausert. Beziehungen und, damit verbunden, das genaue Beobachten und Beschreiben von Menschen haben mich immer interessiert - und werden auch weiterhin im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen.
Weder Unterhaltungsschreibern noch Beziehungsschriftstellern wird in der österreichischen Literaturszene ein wichtiger Stellenwert zugesprochen . . .
Das stimmt. Früher hat mich das auch verletzt. Ich habe mich gefragt, warum ich von dieser Seite derart ignoriert werde. Kulturjournalisten haben einen hohen, elitären Anspruch an die Literatur. Oft gilt in diesen Kreisen der Versuch, etwas einfach, witzig und pointiert zu beschreiben, schon als Vergehen. Ich selbst habe großen Respekt vor klugen Büchern, bevorzuge aber als Schreibender und Leser eher einen leicht lesbaren Stil. Mein Ignoriertwerden hat wohl auch mit meinem Beruf als Journalist zu tun gehabt. Ich wurde von vielen Kritikern lange Zeit nicht als Schriftsteller wahrgenommen, sondern als Journalist, der nebenbei halt Bücher schreibt. Und ein Journalist, der es wagt, die Seiten zu wechseln und Journalismus mit Schriftstellerei zu vermischen, ist in der österreichischen Kulturszene nicht gern gesehen. Das hat auch mit der Kleinheit und Enge des Landes zu tun: Jeder darf nur einen Beruf haben. Kulturjournalisten scheinen dann besonders irritiert zu sein, wenn einer von ihnen nun das macht, worüber sie schreiben.
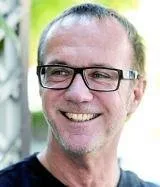
Sie sind ja einer der wenigen Journalisten, der seine Leserzahlen durch Bücher immens vervielfacht hat. Bei den meisten, die ebenfalls die Seiten wechseln, ist es jedoch umgekehrt - sie erreichen mittels Zeitung mehr Publikum!
Das rührt vielleicht daher, dass ich meinem Metier im Grunde treu geblieben bin. Ich habe zwar mit dem Imagewechsel zu kämpfen gehabt, aber die Tätigkeit des Schreibens hat sich bei mir nicht wesentlich verändert. "Theo" zum Beispiel war für mich nicht hauptsächlich eine literarische, sondern eine journalistische Herausforderung. Ich wollte dieses Kind, meinen Neffen, von der Geburt, ja von der Frühgeburt an so ehrlich und aufrichtig wie möglich beschreiben. Die Lust, mich in andere Menschen hineinzuversetzen, hatte ich auch schon bei meiner journalistischen Arbeit. Erst in meinen längeren Texten über Theo, die in dem Buch ebenfalls enthalten sind, ist er von einer realen Person zu einer Art Kunstfigur geworden.
Wie geht´s Theo damit, dass er nun eine öffentliche Figur ist, dass sein Name auf T-Shirts und Papiersackerln prangt und seine Geschichte nun wieder neu aufgelegt wurde?
Es geht ihm gut damit. Das beruhigt mich sehr. Nicht auszudenken, wenn er das Theo-Projekt abgrundtief peinlich finden würde, jetzt, wo es erst so richtig populär wird. Theo ist bald sechzehn, pubertär, ein bisschen scheu und natürlich auch verletzlich. Es hat ihn gekränkt, als er ein paar böswillige Postings auf der "Standard"-Homepage gelesen hat, die ihm unterstellen, ein langweiliges oder schrecklich obergescheites Kind zu sein. Auch ich finde das unfair. Die Kritik müsste ja auf mich abzielen. Aber sonst geht es Theo mit unserer Geschichte sehr gut. Er hat es immer genossen, alljährlich vor Weihnachten fotografiert zu werden, und bei unseren Interviews ging es immer lustig zu. Ich habe ihm kürzlich einen Anteil an den Tantiemen für das Theo-Buch zukommen lassen, weil er ja sozusagen Mitautor ist. Das hat ihm natürlich auch gefallen.
Ist "Theo", ebenso wie Ihr Kinderbuch "Rainer Maria sucht das Paradies", nicht ein Beleg dafür, dass Sie sich nicht nur in Frauen sehr gut hineinversetzen können?
Gewiss ist es für mich als Mann spannend, mich in eine Frau hineinzudenken, aber dass ich seit "Gut gegen Nordwind" oft als reiner "Frauenversteher" abgestempelt werde, stört mich schon ein bisschen. Ob Frauen, Männer, Kinder oder Nacktschnecken - ein Schriftsteller sollte sich in alle seine Figuren hineinversetzen können, das gehört zu seiner Profession.
Trotzdem übt Ihre Einfühlsamkeit offenbar eine besondere Anziehungskraft auf Frauen aus. Der Großteil Ihrer begeisterten Leserschaft ist weiblich. Ist Ihre Frau nicht eifersüchtig, wenn weibliche Fans Sie mit Leo Leike verwechseln?
Zum Glück nicht. Sie weiß, dass diese Verehrung nicht mir als Person, sondern hauptsächlich meiner Romanfigur Leo gilt. Und sie weiß vor allem, dass ich das ebenfalls weiß. Den Rummel bei den Lesungen nimmt sie sehr gelassen hin. Das gehört eben zu meiner Arbeit. Leo und ich haben übrigens gar nicht so viel gemeinsam. Ich möchte jetzt nicht eingebildet wirken oder mit ihm konkurrieren, aber er hat eindeutig weniger Antrieb als ich, ist zögerlicher und zurückhaltender. Erst wenn er etwas getrunken hat, geht er so richtig aus sich heraus. Okay, das verbindet uns . . .
"Gut gegen Nordwind" und "Alle sieben Wellen" sind auch als Theaterstücke sehr erfolgreich. Gefällt es Ihnen, wenn Sie Leo und Emmi auf der Bühne sehen?
Ich finde, die Darstellung auf der Bühne gibt den Figuren eine zusätzliche Dimension. Bei dieser Geschichte ist ja nicht der Plot das Um und Auf, sondern die Sprache, die auch mündlich gut rüberkommt. Witzigerweise habe ich jetzt sogar eine Goldene Schallplatte für 100.000 verkaufte Hörbücher von "Gut gegen Nordwind" bekommen. Mittlerweile habe ich Emmi und Leo in der Darstellung vieler Schauspieler gesehen: von großen, kleinen, dicken, dünnen, sehr attraktiven und weniger ansehnlichen - und es hat immer gepasst. Die Figuren waren glaubwürdig und das Stück hat in jeder Inszenierung einen eigenen Sog entwickelt. Ich hatte zwar beim Schreiben nie an ein Theaterstück gedacht, aber unbeabsichtigt die idealen minimalistischen Voraussetzungen dafür geschaffen: zwei Personen, wenig Bühnenaufwand.
Ab wann wissen Sie, ob ein Thema, ein Stoff, eine Idee geeignet ist, ein ganzes Buch - oder Stück - zu tragen?
Das weiß ich immer erst, wenn ich ungefähr bei der Mitte des Manuskriptes angelangt bin. Dass ich mich einmal in eine richtige Sackgasse geschrieben hätte, ist mir zum Glück noch nie passiert, aber um die Mitte herum gibt es jedes Mal einen Wendepunkt, wo ich die Geschichte neu überdenken und den ursprünglichen Plan oft abändern muss. Auch bei "Gut gegen Nordwind" war das so: Als ich begonnen hatte, die Geschichte zu schreiben, war ich überzeugt, dass sich Emmi und Leo begegnen müssen. Aber ab etwa der Mitte habe ich umdisponiert und gedacht, es wäre besser, sie treffen sich nicht.
Dass sie am Ende nicht zusammen gekommen sind, haben Ihnen viele Leser, vor allem viele Leserinnen übel genommen. . .
Manche nehmen mir auch übel, dass die beiden in "Alle sieben Wellen" nun doch zusammenkommen. Ich selber habe ja einen ausgesprochenen Drang zum Happy-End, doch das Ende von "Gut gegen Nordwind" hatte ich keinesfalls als unbefriedigend empfunden. Gut, das Wunder ist ausgeblieben, aber die beiden haben eine wunderschöne Zeit miteinander verbracht, sich gegenseitig Sehnsüchte erfüllt, und wenn sie beide fortan getrennte Wege gehen, ist das auch nicht schlimm. Emmi ist verheiratet und Leo wird sicher eine Frau finden, die ihn glücklich macht. So habe ich mir das gedacht. Aber da haben mich die Leserinnen eines Besseren belehrt, und irgendwann war ich soweit, dass ich eine Fortsetzung schreiben wollte. Mittlerweile bin ich froh, dass ich es getan habe. Auch für Emmi und Leo. Und das Happy End ist schon okay, auch wenn mich manche "Literaten" dafür verachten. Es passt zu mir.
Können Sie sich vorstellen, noch einen dritten Band zu schreiben: "Emmi und Leo - zehn Jahre später"?
Momentan ist das schwer vorstellbar, aber es nicht auszuschließen, dass es mich irgendwann einmal zu reizen beginnt. Da es ja wieder ein E-Mail-Roman sein müsste, wäre wohl erst eine Trennung der beiden nötig, und dann müssten sie wieder zusammen kommen. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Daher beschäftige ich mich vorerst lieber mit anderen Projekten. In meinem neuen Roman, an dem ich gerade schreibe, geht es eher um Schattenseiten einer Beziehung. Ich arbeite dabei mit Elementen krimimäßiger Spannung, was ich bei meinen bisherigen Büchern, außer bei "Darum", nicht getan habe. Trotzdem soll es in der Geschichte auch etwas zu lachen geben - und schlecht ausgehen darf sie wahrscheinlich auch nicht. Obwohl - ich bin jetzt ungefähr bei der Mitte angelangt, und da muss ich bekanntlich alles noch einmal neu überdenken. Die Dinge beginnen sich etwas anders zu entwickeln, als ich es erwartet habe. Ich lasse mich gerne von meinen Figuren überraschen.
Würden Sie sich mit einem neuen Buch gescheitert fühlen, wenn die Verkaufszahlen drastisch einbrächen? Ja, schon irgendwie, denn als bekennender Zahlenfreak habe ich eine ungefähre Vorstellung davon, wie sich die Verkaufszahlen meiner Bücher weiterentwickeln müssten. Meine nächsten zwei, drei Bücher sollten im Hardcover jeweils 50.000 bis 100.000 Exemplare verkaufen, also auch das "Theo"-Buch.
Das ist aber doch wohl die untere Grenze. . .
Wenn man es an meinen beiden E-Mail-Romanen misst, schon, ja.
Diese Romane wurden mittlerweile in 35 Sprachen übersetzt. Finden sie im Ausland ebenso viel Zustimmung und Verbreitung wie bei uns?
In Frankreich ist gerade die dritte Auflage erschienen, das heißt, 55.000 Stück sind verkauft, das ist natürlich super, und auch in Spanien stehe ich auf den Bestsellerlisten. Dort gibt es sogar eine spanische und eine katalanische Ausgabe. Auch in Südkorea, wo übrigens die allererste Übersetzung herauskam, laufen die beiden Bücher fantastisch, und in Lettland und Litauen werden sie gerade zu Bestsellern. Die Bücher funktionieren also offenbar auch bei anderen Mentalitäten und Nationalitäten.
In Indonesien wurde "Gut gegen Nordwind" ebenfalls aufgelegt, aber davon habe ich bisher noch kein einziges Exemplar gesehen, das ist wohl irgendwie verloren gegangen oder verschollen. Interessant ist auch, wie die Bücher im Ausland aussehen: Die Bulgaren etwa haben ein Bild des Schauspielerpärchens, das "Gut gegen Nordwind" in Berlin spielte, aufs Cover gegeben.
Aus Existenzgründen müssten Sie also gar keine Bücher mehr schreiben. . .
Stimmt, aber aus Existenzgründen schreibt ohnehin niemand ein Buch. Also werde ich munter weiterschreiben. Das Einzige, was mir in meinem Dasein als Schriftsteller manchmal abgeht, sind die Kollegen, die man als Journalist ständig um sich hat. Man arbeitet zwar allein, gehört aber doch zu einem Team. Als Schriftsteller arbeitet man nur für sich. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, noch einmal in den Journalistenberuf zurückzukehren. Hingegen könnte ich mir durchaus vorstellen, etwa als Mediator zu arbeiten. Eine solche Ausbildung möchte ich gerne machen. Das hängt natürlich auch wieder mit meinem grundlegenden Bedürfnis zusammen, mich in andere Menschen hineinzudenken.
Wenn Sie sich jetzt bitte noch einmal in einen Journalisten hineindenken: Welche Frage - die Ihnen vielleicht noch niemand gestellt hat - würden Sie sich selber stellen?
Da fällt mir nur eine absolut traumatische Frage ein, die niemand zu stellen wagt, weil es auch sehr unhöflich wäre, sie zu stellen. Sie hat sich mir am Ende von Interviews, die ich selbst geführt habe, jedoch manchmal aufgedrängt. Die Frage lautet: Glauben Sie allen Ernstes, dass das irgendjemanden interessieren könnte, was Sie uns soeben erzählt haben?
Zur Person
Daniel Glattauer, geboren 1960, wuchs in Wien-Favoriten auf und studierte Pädagogik und Kunstgeschichte. Nach Abschluss des Studiums (mit der Diplomarbeit "Das Böse in der Erziehung") arbeitete er drei Jahre für "Die Presse" und wechselte dann, nach einem kurzen Gastspiel bei dem Wirtschaftsmagazin "Cash Flow", zum "Standard", wo er vor allem Gerichtsreportagen, Feuilletons und die Kolumne "dag" auf der Titelseite (im sogenannten "Einserkastl") schrieb. Diese Glossen sind in den Büchern "Die Ameisenzählung" (2001), "Die Vögel brüllen" (2004) und "Schauma mal" (2009) versammelt.
Seit 2009 ist Glattauer freier Schriftsteller.
Nach seinen Romanen "Der Weihnachtshund" (Neuausgabe 2004) und "Darum" (2003) sind ihm mit den beiden "E-Mail-Romanen" "Gut gegen Nordwind" (2006) und "Alle sieben Wellen" (2009) zwei Bestseller gelungen, die mittlerweile in 35 Sprachen übersetzt wurden und auch als Hörbücher und Theaterstücke international erfolgreich sind. Soeben ist sein Buch "Theo. Antworten aus dem Kinderzimmer" neu und erweitert aufgelegt worden - wie alle seine Bücher bei Deuticke. Glattauer beschreibt darin das Leben seines Neffen von der Geburt bis zur beginnenden Pubertät.
Daniel Glattauer lebt in Wien und im Waldviertel, ist verheiratet und hat den inzwischen erwachsenen Sohn seiner Frau mit aufgezogen. Am 14. September liest Glattauer im Schauspielhaus (1090 Wien, Porzellangasse 19, 20 Uhr) aus dem "Theo"-Buch. Und beim Wiener Literaturfestival "Rund um die Burg" tritt er am 18. September um 15.30 Uhr im Zelt auf.
Irene Prugger lebt als Schriftstellerin und freie Journalistin in Mils/ Tirol.
Gerald Schmickl ist leitender Redakteur des "extra" und Schriftsteller.