Für mehr Klimaschutz sind mittlerweile fast alle Politiker. Über notwendige unpopuläre Maßnahmen spricht aber kaum jemand.
Wien. Als der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore im Jahr 2006 seinen wegweisenden Dokumentarfilm herausbrachte, nannte er diesen "Eine unbequeme Wahrheit". Gore wollte damit vor allem darauf hinweisen, dass der menschengemachte Klimawandel real ist und eine existenzielle Bedrohung für unseren Planeten darstellt. Heute, 13 Jahre nach der Veröffentlichung des Films, gibt es kaum noch ernsthafte Zweifel daran, dass der seit Beginn der Industriellen Revolution massiv angestiegene Ausstoß von Treibhausgasen dafür verantwortlich ist, dass sich die Erde sukzessive überhitzt. Und auch in der öffentlichen Debatte hat sich das Problem mittlerweile mit ungeheurer Wucht manifestiert: Klimaschutz ist zu einem der zentralen globalen Themen geworden.
Doch der Einsicht, dass dringend gehandelt werden muss, sind bisher nur bedingt Taten gefolgt. Selbst in Europa, wo man sich gerne als Vorreiter der Klimaschutzbewegung sieht, ist laut einer Studie der European Climate Foundation kein einziger Staat bei der Erreichung der Energie- und Klimaziele für 2030 auf Kurs. Und nach wie vor tun sich die allermeisten Politiker sehr schwer damit, ihren Wählern reinen Wein einzuschenken. Denn auch beim Klimaschutz gibt es eine ganze Reihe unbequemer Wahrheiten. So wird der Kampf gegen die Erderwärmung nicht nur enorm viel Geld kosten, es werden auch viele unpopuläre Entscheidungen getroffen werden müssen, wie die folgende Übersicht zeigt.

Ohne Atomkraft wird es mancherorts nicht gehen
Nach der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 entschieden sich viele Länder - etwa Deutschland - für den Atomausstieg. Frankreich, Großbritannien, aber auch die zentral- und osteuropäischen Staaten wie Polen, Bulgarien oder Ungarn treten indes vehement für die Subventionierung von Atomenergie ein. Denn diese ist zwar heftig umstritten - für hochradioaktiven Müll gibt es weltweit noch kein einziges Endlager -, in Frankreich hat sie aber zum Beispiel einen Anteil von mehr als 70 Prozent an der gesamten Stromproduktion des Landes. Und laut der Internationalen Energieagentur (IEA) ist die Atomenergie mit einem Anteil von zehn Prozent an der weltweiten Stromversorgung aktuell die zweitwichtigste emissionsarme Energiequelle, nach Wasser mit 16 Prozent. Für entwickelte Ökonomien wie die USA, Kanada, Japan oder die EU ist Atomenergie laut IEA sogar die wichtigste nicht fossile Stromquelle.
Angesichts des Klimawandels und des erklärten Ziels, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, dürfte die Rolle der Atomenergie daher kaum geringer werden. Denn ohne Kernkraftwerke werden viele Länder die Energiewende vermutlich nicht schaffen. Die einzelnen Staaten stehen vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen im Bestreben, ihre Treibhausgase zu drosseln, weil deren Energiemix unterschiedlich ist. Spinnt man den Gedanken der Elektromobilität weiter, wird der Strombedarf zudem stark steigen. Und nicht jedes Land kann wie Österreich auf seine Wasserkraft bauen. Setzt man auf Alternativen wie Wind- oder Solarenergie, ist deren Ausbau und die Errichtung der entsprechenden Infrastruktur teuer und nicht überall möglich. Wind und Sonne erzeugen außerdem nicht rund um die Uhr Energie. Werden die Lücken durch Kohlekraftwerke gefüllt, ist das kontraproduktiv und innerhalb der EU ab 2025, wenn keine Förderungen mehr an Kohlekraftwerke vergeben werden dürfen, ohnehin so gut wie unmöglich.
Die Kreislaufwirtschaft ist eine Herausforderung
Um klimaneutral zu werden, reicht es nicht, nur die fossilen Energiequellen durch andere zu ersetzen. Der globale Energiebedarf muss sich grundsätzlich reduzieren. Und das wird vor allem in den reichen Industriestaaten das Leben der Menschen verändern. Der Konsum muss nachhaltiger, die Nutzungsdauer der Produkte langlebiger und der Abfall deutlich reduziert werden. Doch was bedeutet das für unser auf immer mehr ausgerichtetes Wirtschaftssystem? Ist die Zeit des Wirtschaftswachstums am Ende? "Das würde ich so nicht sagen", erklärt Sigrid Stagl, Leiterin des Instituts für ökologische Ökonomie an der WU Wien.
Klar ist, dass es eine große Umstellung bedeutet. Dennoch kann weniger auch mehr sein, was die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung anbelangt. Erstens sind Produkte, die länger halten und/oder wiederverwendet werden können, teurer, sie wirken also zunächst positiv aufs Wirtschaftswachstum. Und auch wenn das langfristig vielleicht nicht so sein mag: Es entstehen neue Felder und neue Jobs, wenn Waschmaschinen, Hemden, Schuhe und Reindl wieder repariert und geflickt werden.
Es ist auch nicht so, dass die Menschen mit einer derartigen Kreislaufwirtschaft noch nie gelebt hätten. Im Gegenteil, der Großteil lebt nach wie vor so, nur in den Industriestaaten ist es eher zur Ausnahme geworden. Dafür muss allerdings die Politik steuernd eingreifen. "Waschmaschinen könnten zum Beispiel offen produziert werden müssen, damit sie von allen repariert werden können, nicht nur vom Hersteller", sagt Stagl.
Ob das Neue, das dadurch entsteht, den Verlust des Alten aufwiegen kann und das Wirtschaftswachstum langfristig gesichert werden kann, lässt sich heute nicht prognostizieren. Gut möglich auch, dass die Verluste eher außerhalb Europas liegen, dort wo heute mit wenig Nachhaltigkeit produziert wird: billige Kleidung, Elektrogeräte, Metallwaren und so weiter. "Klimapolitik ist auch Handelspolitik", sagt Stagl. Die europäische Industrie könnte daher wieder wettbewerbsfähig werden. Wenn sich der Umstieg auf eine Kreislaufwirtschaft aber tatsächlich negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirkt, muss das auch noch keine Tragödie sein. Eine Herausforderung ist es allemal. "Weil unsere sozialen Systeme nur unter der Bedingung des Wirtschaftswachstums funktionieren", sagt Ökonomin Stagl. Pensionen, Bildung, Arbeitsmarkt - das alles verlangt nach dem "immer Mehr". "Und ein Umstieg ist alles andere als trivial."
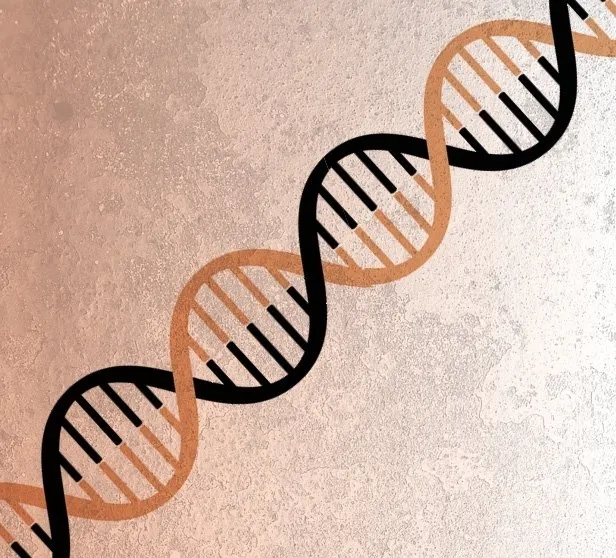
Ohne Gentechnik wird es schwierig werden
Mehr als 7,7 Milliarden Menschen leben derzeit auf der Erde - und es werden stetig mehr. Der UN-Bevölkerungsprojektion 2019 zufolge könnten es bis Ende des Jahrhunderts bereits fast elf Milliarden sein. Elf Milliarden Menschen, die essen müssen, um zu überleben - insgesamt um einiges mehr als heute. Doch die Nahrungsmittelproduktion braucht Platz.
Das alles könne nur dann funktionieren, wenn man die Erträge auf den bestehenden landwirtschaftlichen Nutzflächen in den kommenden Jahrzehnten um eine Größenordnung von 50 Prozent steigert, sagt Joachim von Braun, Professor für wirtschaftlichen und technologischen Wandel an der Universität Bonn. Und zwar mithilfe von Pflanzenzüchtung, auch unter Verwendung neuer Technologien wie Gentechnik. Denn wenn sämtliche Weiden und Wälder zu Äckern werden und damit wichtige CO2-Speicher wegfallen, steigt die Klimagas-Konzentration nur noch weiter an.
Und selbst dann wäre die Fläche laut von Braun immer noch zu wenig. Ein wesentlicher Mosaikstein für die globale CO2-Reduktion braucht nämlich ebenfalls enorm viel Platz: die Biomasseproduktion im Sinne der Bioökonomie. Bei der Bioökonomie geht man davon aus, dass alle fossilen durch nachwachsende Rohstoffe wie etwa Mais ersetzt werden, damit die Wirtschaft wachsen kann, ohne die Umwelt zu belasten. Ohne Technologien wie etwa Gentechnik, die die Pflanzen zum Beispiel rasch und effizient widerstandsfähiger gegen Schädlinge machen, könnte die Biomasseproduktion in direkte Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion treten. Schon jetzt ist das Phänomen des Land Grabbings ein massives Problem: Wirtschaft und Politik eignen sich in Entwicklungs- oder Schwellenländern Land an, um dort anzubauen.

Fliegen wird noch lange klimaschädlich sein
Viele Jahrzehnte lang kannte die Luftfahrbranche keine Imageprobleme. Das Flugzeug brachte nicht nur Geschäftsreisende schnell und einfach ans Ziel, sondern öffnete auch für viele Normalbürger das Tor zur Welt. Für europäische Touristen war auf einmal nicht mehr die italienische Adria das Ende des persönlichen Erfahrungshorizontes, sondern Länder wie Kambodscha, Australien oder Chile.
Doch mit der Klimaschutzdebatte hat das Fliegen seine Unschuld verloren. Denn mit einem im Vergleich zur Bahn um bis zu sieben Mal höheren C02-Ausstoß pro Personenkilometer ist das Flugzeug mit Abstand das klimaschädlichste Verkehrsmittel. Und so schnell dürfte sich daran auch nichts ändern. Anders als im Verkehr auf der Straße oder bei der Energiegewinnung steht bei Flugzeugen nämlich mittelfristig keine technische Alternative zu den derzeit eingesetzten Verbrennungsmotoren zur Verfügung. So bringt der enorme Energiebedarf von Flugzeugtriebwerken batterieelektrische Lösungen schnell an ihre Grenzen. "Für 150 bis 270 Passagiere ist das mit den heutigen Batterietechniken nicht machbar", sagt Lars Wagner, Technikvorstand beim Münchner Triebwerksbauer MTU. Die Akkus wären einfach viel zu schwer.
Ebenso wenig praxistauglich ist Bio-Kerosin aus nachwachsenden Rohstoffen. So erprobt die deutsche Lufthansa schon seit dem Jahr 2011 die Beimischung von grünen Treibstoffen, doch schon längst ist klar geworden, dass damit auch eine Wiederauflage der Debatte Tank-versus-Teller droht, die schon die Einführung von Auto-Biotreibstoffen begleitet hat. Denn die weltweiten Anbauflächen sind viel zu klein, um die Nahrungsmittelversorgung der stetig anwachsenden Weltbevölkerung zu gewährleisten und den gewaltigen Energiehunger der Airline-Branche zu stillen.
Als klimafreundliche Zukunftsvision für die Luftfahrt bleibt damit eigentlich nur noch synthetisches Flugbenzin über. Dieses wird etwa erzeugt, indem Wasserstoff per Elektrolyse aus dem Wasser herausgelöst und dann mit Umgebungs-CO2 zu Treibstoff weiterverarbeitet wird. Bei der Verbrennung wird das CO2 zwar wieder freigesetzt, weil es zuvor aber der Umwelt entzogen wurde, entsteht ein klimaneutraler Kreislauf.
Doch das sehr energieintensive Power-to-Liquid-Verfahren steckt derzeit noch in den absoluten Kinderschuhen. So soll in Deutschland eine erste Pilotanlage für synthetisches Flugbenzin erst 2023 starten. Und bis flächendeckend Flugzeuge damit betankt werden, dürften überhaupt viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vergehen. Gegen das schlechte Gewissen beim Fliegen helfen damit vorerst nur zwei Dinge: die von den Airlines angebotenen CO2-Kompensationszahlungen, mit denen anderswo Klimaschutzprojekte finanziert werden, und weniger oft zu fliegen.
Die Sharing Economy wird die Welt nicht retten
Die Idee klingt auf den ersten Blick bestechend: Weil Ferienwohnungen oft nur ein paar Tage oder Wochen im Jahr genutzt werden und Privatautos die meiste Zeit nur herumstehen, wäre es doch sinnvoller, solche Dinge gemeinsam zu nutzen. Und das nicht nur aus unmittelbar persönlich wirtschaftlichen Überlegungen, die den Besitz eines nur selten gebrauchten Gutes als ökonomisch wenig sinnvoll erscheinen lassen. Denn wenn Autos und Wohnungen, aber auch viele andere Dinge wie Werkzeuge oder Kleidung, geteilt werden, sollte das der Theorie nach auch dem geschundenen Planeten helfen. Es werden weniger Ressourcen für die Produktion verbraucht und es entstehen weniger Müll und Emissionen.
Doch zumindest in Sachen Umwelt- und Klimaschutz hat die Sharing Economy, die durch das Teilen statt Besitzen auch die Welt besser machen wollte, bisher kaum ihren eigenen Anspruch erfüllt. So zeigt eine vor kurzem veröffentlichte Studie der Unternehmensberatung A.T. Kearny sehr deutlich, dass die gemeinsame Nutzung der Ressource Auto im Rahmen des Car-Sharings bei Weitem nicht so nachhaltig ist, wie das oftmals behauptet wird.
Als Beleg dafür wird unter anderem die Zahl der Auto-Neuzulassung in den beiden großen deutschen Städten Hamburg und Berlin angeführt. Denn diese ist seit dem Markteintritt der mittlerweile fusionierten Branchenriesen Car2go und DriveNow vor acht Jahren nicht signifikant gesunken. Laut der Studie nutzen die Car-Sharing-Kunden das Angebot nämlich auch sehr stark aus Bequemlichkeitsgründen, etwa wenn das eigene Auto gerade nicht verfügbar ist. Und das geht sehr häufig zulasten des klimafreundlichen öffentlichen Nahverkehrs.
Statt zehn oder fünfzehn Minuten auf den nächsten Bus zu warten, wird nun in vielen Fällen das um die Ecke stehende Teil-Auto genommen. Städte wie Stockholm rudern deswegen sogar schon beim Car-Sharing zurück.
Nicht viel besser sieht auch die Klimabilanz beim Teilen von Wohnungen aus. Denn Plattformen wie beispielsweise Airbnb haben zwar dazu geführt, dass langfristige Mieten für die einheimische Bevölkerung in beliebten Touristenstädten wie Barcelona oder Paris deutlich teurer geworden sind, für den einzelnen Besucher, der nur kurze Zeit bleibt, ist es im Vergleich zu früher aber deutlich günstiger. Und das hat direkte Auswirkungen auf das Reiseverhalten. So hat die US-Soziologin Juliet Schor herausgefunden, dass Nutzer von Airbnb aufgrund der günstigen Zimmerpreise häufiger in den Urlaub fliegen und damit auch mehr CO2-Emissionen verursachen.
Brückentechnologien werden nicht sauber sein
In rund 600.000 Haushalten in Österreich wird nach wie vor mit klimaschädlichem Öl geheizt. Notwendig wäre das grundsätzlich nicht - oder nur in wenigen Fällen. Das heißt aber nicht, dass heute schon alle diese Heizungssysteme auf erneuerbare Energie umgerüstet werden könnten. Doch würde man Ölheizungen von heute auf morgen auf Erdgas umstellen, würde sich auch dadurch eine durchaus substanzielle Einsparung von CO2-Emissionen ergeben. Ebenso verhält es sich mit Gas statt Benzin als Treibstoff.
Freilich, langfristig ist diese Art der Substitution von Energieträgern ein Problem, weil das Ziel die komplette Klimaneutralität ist. Doch Brückentechnologien wird man jedenfalls in der Phase des Umstiegs benötigen. Das Problem dabei: Gerade in der Industrie, aber auch bei Privathaushalten, wenn es etwa um Heizungen geht, werden Investitionen oft sehr langfristig getätigt. Das heißt auch, dass bei der Wahl einer Brückentechnologie als Energielieferant die Nutzungsdauer beachtet werden muss.

Wir werden auf vieles verzichten müssen
In jedem Fall ist das Zauberwort zur Bewältigung der Klimakrise Verzicht. Verzicht auf Energie, auf das Zweitauto, die fünfte Billigjeans im Kleiderkasten, auf Nahrung im Überfluss, auf die tägliche Portion Fleisch oder Wurst auf dem Teller. Die Rechnung ist nämlich denkbar einfach: Wer weniger Energie verbraucht und mit dem Zug statt mit dem Auto in die Arbeit fährt, produziert weniger CO2. Wer seine Jeans nicht nach einer Saison wegwirft, um sich eine neue zu kaufen, unterstützt damit auch nicht deren energieintensive Produktion und den Vertrieb. Und wer weniger Fleisch isst, wirkt damit gleich einer ganzen Kette an klimaschädlichen Faktoren entgegen: Laut dem aktuellen Sonderbericht des Weltklimarates IPCC wird nämlich bereits mehr als ein Viertel der globalen Landfläche unseres Planeten als Weideland oder für den Anbau von Tierfutter genutzt. Allein für die Fleischproduktion in Österreich werden laut Bericht pro Jahr mehr als 500.000 Tonnen Soja aus Übersee importiert, für die oft wichtige Wälder abgeholzt werden. Und die Kühe selbst stoßen bei der Verdauung Methan aus: neben CO2 ein weiteres starkes Treibhausgas.
Verzicht muss angesichts all dessen aber nicht unbedingt negativ konnotiert sein. Einerseits wird derzeit jedes Jahr rund ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel weggeworfen oder geht entlang der Wertschöpfungskette verloren. Andererseits gilt eine fleischärmere, pflanzenbasierte Ernährung grundsätzlich als gesünder, weil vor allem Ballaststoffe und ungesättigte Fettsäuren einem Herzinfarkt oder Schlaganfall vorbeugen können. Und mit dem Zug in die Arbeit zu fahren, kann mitunter entspannender sein, als im Stau zu stecken. Wer verantwortungsbewusster mit Energie, Nahrung und Ressourcen umgeht, empfindet den Verzicht auf gewisse Produkte vielleicht gar nicht mehr als solchen.
