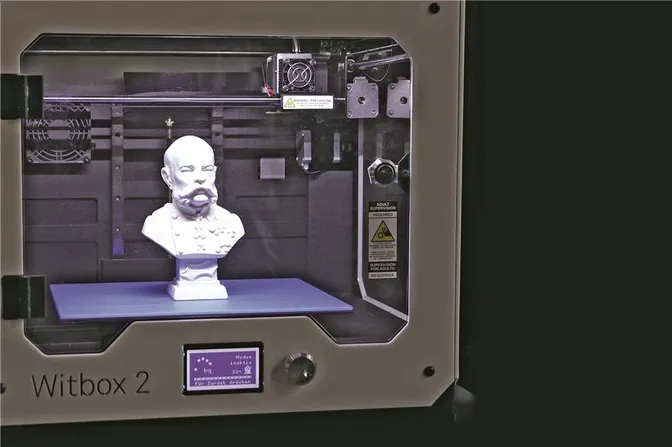Kaiser Franz Joseph I., der vor 100 Jahren gestorben ist, regierte in einer Zeit gewaltiger ökonomisch-technischer Erneuerungen. Er selbst scheint davon aber nicht allzu viel gehalten zu haben.
<p>Als der 18-jährige Kaiser Franz Joseph im vollen Bewusstsein des Gottesgnadentums seiner Herrschaft am 2. Dezember 1848 den Thron bestieg, ereignete sich nichts Geringeres als die Verwandlung der Welt im 19. Jahrhundert: Im selben Jahr veröffentlichte Karl Marx unter dem Eindruck der rasanten Industrialisierung auf dem Rücken der ausgebeuteten Arbeitermassen das "Kommunistische Manifest". In England wurde in diesen Jahren der Zehn-Stunden-Tag eingeführt, in Deutschland der Zwölf-Stunden-Tag gefordert. Selbst Jugendliche mussten bis zu 16 Stunden arbeiten. Die ersten Dampfschiffe fuhren zwischen Deutschland und den USA im Linienverkehr, der Elektrokonzern Siemens & Halske wurde gegründet, Thomas Alva Edison und Henri Becquerel, der spätere Entdecker der radioaktiven Strahlung, wurden geboren. Fernmelde- und Nachrichtenwesen boomten, das erste Tiefseekabel zwischen Dover und Calais ging in Betrieb. Die erste Chloroform-Narkose wurde getestet, Ignaz Semmelweis bekämpfte erfolgreich das Kindbettfieber.<p>In Österreich versuchten der junge Kaiser und seine Minister das Rad der Geschichte politisch vor das Revolutionsjahr 1848 zurückzudrehen, förderten aber Wirtschaft und Industrie. Österreich lag zwar hinter England oder Belgien, das Eisenbahnnetz umfasste einschließlich Ungarn erst rund 1500 Kilometer, aber es wuchs rasant. Die Entscheidung für den Bau der Semmeringstrecke war gefallen. Carl Ghega wurde im August 1848 Generalinspektor der Staatsbahnen, drei Jahre später "Ritter von Ghega". Der Eisenbahnbau kann als Schlüsselbranche für die industrielle Entwicklung im 19. Jahrhundert gelten: Eisen- und Stahlindustrie, Maschinen- und Fahrzeugbau und die Bauwirtschaft hingen am Bahnbau. Die Eisenbahn revolutionierte den Warenaustausch, sie erweiterte den Aktionsradius der Produktions- und der Handelsbetriebe ebenso wie die Mobilität der Menschen.<p>
Reformen von oben
<p>Das einst revolutionäre Bürgertum wurde mit der Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand geködert. "Der Neoabsolutismus wurde zum Vorkämpfer des ökonomischen Fortschritts", konstatiert der Wirtschaftshistoriker Herbert Matis für die Zeit zwischen 1848 und 1859. Verwaltung, Justiz, Finanz- und Bildungswesen sowie weite Bereiche der Wirtschaft wurden "von oben" völlig umgekrempelt, zum Beispiel wurden 1859 die Handelskammern gegründet. Dazu der Wirtschaftsforscher und Historiker Felix Butschek zur "Wiener Zeitung": "Das waren wichtige Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung. Die kann nur dann optimal verlaufen, wenn eine korrekte, nicht korrupte, effiziente Beamtenschaft existiert, wenn der Rechtsstaat funktioniert."<p>Franz Joseph-Biograph Karl Vocelka zur Rolle des jungen Monarchen: "Er hat schon mitvollzogen, wenn ihm etwas nicht gerade gegen den Strich gegangen ist, aber das war nicht eine von ihm bewusst konstruierte Wirtschaftspolitik. Die Eisenbahn war für den Truppentransport interessant, aber in die Planung greift er nicht ein. Er selber hat ja schon als Kind eine Spielzeuglokomotive gehabt, die nach einer Lokomotive der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn gebaut worden ist."<p>Eine direkte Errungenschaft der Revolution von 1848 war die Bauernbefreiung, sie überlebte den politischen Kahlschlag durch den Neoabsolutismus. Grundherren wurden zu Großgrundbesitzern und Investoren etwa in der Nahrungsmittelindustrie. Die Teebutter hatte ursprünglich nichts mit Tee zu tun, sondern bedeutete "Teschener Erzherzogliche" Butter, ist also eine Marke mit Hinweis auf Erzherzog Albert von Teschen-Sachsen, der eine Molkereiindustrie aufbaute. Viele Bauern konnten ihren Anteil am Preis für die Freiheit nicht zahlen, mussten verkaufen und wegziehen. Aus der Landbevölkerung, Männer wie Frauen, rekrutierte sich daher zu einem großen Teil das Heer der Proletarier im neuen industriellen Zeitalter.<p>
Knochenarbeit
<p>Wie es damals auf Großbaustellen zuging, zeigt ein Blick auf den Bau der Semmeringbahn um 1850. Mehr als 10.000 Männer und Frauen waren auf dem engen Raum entlang der neuen Bahnstrecke zusammengepfercht. Im offiziellen Wien war man froh, nach der Revolution viele "Unruhestifter" weit weg zu wissen. Auch Frauen, die "Mörtelweiber", arbeiteten schwer als Zuträgerinnen.<p>Die Ernährung war ebenso katastrophal wie die Unterbringung in Baracken. 1850 brach eine Choleraepidemie aus, zwei Jahre später eine Typhusepidemie mit hunderten Todesopfern. Der Bauunternehmer Ferdinando Tallachini blieb Löhne schuldig, es kam zu Ausschreitungen. 1854 war die Strecke fertig. Am 12. April fuhr der junge Kaiser unter "Allerhöchstem Wohlgefallen" mit Herrn von Ghega erstmals von Mürzzuschlag nach Gloggnitz. 1857 war der Bau der Südbahn bis Triest abgeschlossen.<p>Die Lebensumstände der Menschen im 19. Jahrhunderts hat der Wirtschafts- und Sozialhistoriker Roman Sandgruber dargestellt. Zum Beispiel brauchte eine Beamtenfamilie um das Jahr 1857 mit drei Kindern und einem Dienstboten einen Betrag von 500 Gulden im Jahr. Das wären nach Berechnungen der Statistik Austria knapp 6000 Euro. Was hat man dafür bekommen? Fast drei Fünftel waren für das Essen in dem Sechs-Personen-Haushalt bestimmt. "Um sich anständig zu kleiden", wie es in dieser Konsumerhebung heißt, 57 Gulden, zum Beispiel "alljährlich ein neues Beinkleid um 5 Gulden", oder "alle 2 Jahre einen neuen Rock zu 10 Gulden" (rund 120 Euro.) Der Mietzins wird mit 30 Gulden angesetzt, dazu kommen "um anständig zu wohnen" Holz, Kerzen, Seife oder Kaminfegen, insgesamt 86 Gulden (rund 1000 Euro). Da sind 18 Gulden Dienstbotenlohn dabei, bei freiem Essen und Quartier.<p>

Damit liegt diese Beamtenfamilie im unteren Drittel der Einkommenspyramide, gemeinsam mit Hauptleuten in der Armee, kleinen Grundbesitzern, oder Gewerbetreibenden. Arbeiterinnen und Arbeiter mussten mit 100 Gulden im Jahr auskommen. Ganz oben sind rund 2000 Personen, mit einem Jahreseinkommen zwischen 20.000 und 40.000 Gulden (235.000 bis knapp 500.000 Euro) aus dem Kreis der höchsten Beamtenschaft, der Generalität, des hohen Klerus und der Kapitalisten.<p>
Die Kosten des Krieges
<p>Einer der profiliertesten Politiker im Neoabsolutismus war Karl Ludwig Freiherr von Bruck, Handels- und Finanzminister. Der Aufsteiger aus dem Bürgertum war einer der Mitbegründer des Österreichischen Lloyd in Triest. Er wollte über Zollverträge Österreich im Deutschen Bund verankern, förderte den Eisenbahnbau, die Gründung von Banken, reformierte das Postwesen. Wenn der Kaiser mit außenpolitischen oder gar kriegerischen Abenteuern die Staatsfinanzen überstrapazierte, musste der Minister Österreich vor schwerwiegenden Folgen bewahren.<p>Nach der Besetzung weiter Gebiete im heutigen Rumänien im Krimkrieg durch 300.000 Mann mussten die Steuern um 20 Prozent erhöht werden. Vor dem Krieg gegen Frankreich und Sardinien 1859 wären die Alarmglocken rechtzeitig zu hören gewesen: An der Frankfurter Börse stürzten nach ersten Kriegsgerüchten österreichische Staatspapiere auf die Hälfte ihres Wertes. Kaiser Franz Joseph beeindruckte das nicht, er verlor dann höchstpersönlich die Schlacht von Solferino und damit die reiche Lombardei. "Die Monarchie betrieb eine Großmachtpolitik, die mit den finanziellen Verhältnissen nicht in Einklang zu bringen war", urteilt Herbert Matis.<p>Als Bruck dem Kaiser in persönlicher Audienz von einem Korruptionsfall in der Armee berichtete, beteuerte die 30-jährige Majestät, sie habe volles Vertrauen zu ihm. Zu Hause fand Bruck jedoch sein Entlassungsschreiben vor und verübte Ende April 1860 Selbstmord. Eine Untersuchungskommission brachte später Brucks Unschuld zutage. Als Folge des verlorenen Krieges musste Staatseigentum auf den Markt geworfen werden, Staatsgüter ebenso wie die Eisenbahnen, der Wienerwald entging nur knapp der "Verwertung" durch Spekulanten, und Kaiser Franz Joseph musste Schritt für Schritt vom Neoabsolutismus Abschied nehmen.<p>Ein Großprojekt konnte er 1857 noch auf den Weg bringen: Die Ringstraße. Das "Allerhöchste Handschreiben" des Kaisers vom 20. Dezember 1857 dazu hatte Innenminister Alexander von Bach entworfen. Trotz zahlreicher öffentlicher Bauten wurde das Projekt eine lukrative Sache, 850 Gebäude wurden zu drei Vierteln von Privaten errichtet. Dabei wurde auch diskutiert, ob Juden Grund erwerben dürften. Bach war dafür, und es entstanden die Stadtpalais unter anderem der Epstein, der Todesco oder der Ephroussi.<p>Franz Joseph selbst stand den Juden offiziell neutral gegenüber, gestattete sich aber doch persönliche Seitenhiebe, wie Karl Vocelka gegenüber der "Wiener Zeitung" einräumt. So schrieb der Kaiser einmal: "Es wäre schöner, wenn nicht so viele Juden da wären." Einen Antisemitismus wie bei Lueger oder den Deutschnationalen sieht man bei ihm aber nicht, meint Vocelka. "Ich glaube, was er schon gesehen hat, war, dass jüdisches Kapital vorhanden und einsatzfähig war."<p>Ein hoch politisches Projekt war die Weltausstellung von 1873, Höhepunkt und zugleich Ende der erfolgreichen Gründerzeit in Österreich-Ungarn, wie die Monarchie seit 1867 hieß. Es galt, die außenpolitische Isolation nach den Kriegen 1859 und 1866 aufzubrechen, betont Karl Vocelka: "Man versuchte, sich wieder ins internationale Geschehen einzubringen. Der zweite Aspekt ist, dass es schon einen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben hat, in der Gründerzeit. Das sollte der Weltöffentlichkeit gezeigt werden. Und da war Franz Joseph schon sehr dahinter."<p>
Modernisierungsschub
<p>Sein Bruder Erzherzog Karl Ludwig wurde Protektor und Erzherzog Rainer, ein besonders populärer entfernterer Verwandter, wurde Präsident der Weltausstellung. Das Defizit von fast 15 Millionen Gulden, ungefähr fast 180 Millionen Euro, dürfte den Kaiser wenig geschmerzt haben, konnte er doch 66 gekrönte Häupter empfangen.<p>Wien brachte die Weltausstellung einen Modernisierungsschub: Die heutige Schnellbahnstrecke rund um den Praterstern entstand, die erste Donauregulierung wurde vorgenommen, und der Kaiser eröffnete im Oktober 1873 die erste Hochquellenwasserleitung beim Hochstrahlbrunnen.<p>Der persönliche Anteil des Kaisers an den Entscheidungen und an den Planungen ist schwer festzustellen. Denn, so Karl Vocelka: "Er war nicht der, der festhält, wer ihm diesen oder jenen guten Rat gegeben hätte. Das ist nicht sein Stil, er ist ja die kaiserliche Majestät. Er hat kein Tagebuch geschrieben, und Leute, die kein Tagebuch schreiben, sind für die Historiker schlimm. Auch wenn man weiß, dass Tagebücher oft mit Blick auf künftige Veröffentlichung geschrieben werden."<p>
Der Börsenkrach
<p>Am "schwarzen Freitag", dem 9.Mai 1873, war es mit der deutsch-liberal geprägten Erfolgsstory vorbei. Der Börsenkrach erschütterte die Monarchie, nur kurz nachdem der Kaiser die Weltausstellung am 1.Mai feierlich eröffnet hatte. Der Investitionsschub rund um die Weltausstellung hat das Spekulationsfieber und den darauf folgenden Börsenkrach noch angeheizt. Selbst hartgesottene Manchester-Liberale riefen nach staatlicher Hilfe. Und der Kaiser kündigte in seiner Thronrede vom 2. Februar 1874 an: Es sollen sämtliche kostspieligen Feiern zu seinem 25-jährigen Regierungsjubiläum unterbleiben und aus den dafür vorgesehenen Mitteln ein "Kaiser-Franz-Josephs-Fonds" zur Unterstützung des Kleingewerbes geschaffen werden. Um Nahrungsmittel für die Ärmsten zu verbilligen, wurden Einfuhrzölle auf Hülsenfrüchte und Getreide ausgesetzt, was aber die ungarischen Agrarier prompt torpedierten.<p>1874 kam die Wende: Börse und Aktiengesellschaften wurden an den kurzen Zügel genommen. Ein Konjunkturprogramm förderte den staatlichen Eisenbahnbau, nachdem den Privaten das Geld ausgegangen war. Für die Bauwirtschaft gab es Steuererleichterungen.<p>Trotzdem verfiel die Wirtschaft in eine lange Lähmung. Antikapitalismus, Antiliberalismus und Antisemitismus breiteten sich aus. Wirtschaftsforscher und Historiker Felix Butschek: "Die neue Regierung von Eduard Grafen Taaffe hatte einen ganz anderen Ansatz als das liberale Großbürgertum. Sie war stark beeinflusst von der christlichen Soziallehre mit Verständnis für die Arbeiterschaft, war aber vor allem auch bemüht, die kleinen Handwerksbetriebe zu schützen gegen die Konkurrenz der Industrie, die Konkurrenz des Auslandes, und natürlich die Landwirtschaft zu begünstigen."<p>Und, so Butschek: "Die neuen Kollektivverträge wurden auch von den Unternehmern begrüßt, weil dann keine wilden Streiks mehr stattgefunden haben. Das alles hat die ökonomische Entwicklung begünstigt, und die soziale sowieso."<p>Der größte Konzern des Landes, die Alpine Montan, entstand 1881 mit französischem Kapital. Innovationen blieben jedoch oft wegen Kapitalmangels stecken, so das erste Auto von Siegfried Marcus. Eine Ausnahme bildete Carl Auer von Welsbach, der seine Erfindungen in der Lichttechnik unverzüglich der Industrie verkaufte und ein Vermögen machte, Stichwort OSRAM.<p>Der neue Aufschwung setzte um 1895 ein. Ministerpräsident Ernest von Koerber hat versucht, durch ein Wirtschaftsprogramm den Nationalitätenkonflikt zu entschärfen, was ihm aber nicht gelang.<p>
Angst vor dem Telefon
<p>Der alternde Kaiser hatte immer weniger Anteil an den stürmischen Veränderungen in der Monarchie, stellt Karl Vocelka fest: "Man darf nicht vergessen, als die großen Veränderungen eingetreten sind, so um 1880, 1890, war er ja schon nicht mehr der Jüngste. Er ist - wenn man es radikal ausdrücken will - ein Modernisierungsverweigerer gewesen. Mit dem Telefon hat er sich überhaupt nicht anfreunden können. Sein Kammerdiener Ketterl schreibt, wenn das Telefon geläutet hat, ist er ganz hektisch geworden, und hat gerufen, wo ist der Ketterl, wo ist der Ketterl, damit er ihm das Telefon abhebt." Wenn er eine Fabrik eröffnete oder 1909 die Tauernbahn, wenn er in den Phonographen sprach, so erfüllte er seine Herrscherpflicht, mehr nicht.<p>Das Automobil benützte er "selten und ungern", bestätigt Karl Vocelka. Er stieg 1908 mit Englands König Eduard VII. in Ischl zum ersten Mal in ein Auto. Ein Jahr später nahm er von der österreichischen Autoindustrie zwar drei Autos in Empfang, die "innigste Freude", die er dabei empfunden haben soll, war laut Vocelka aber bloß eine Höflichkeitsfloskel. Den Kaiser interessierte das Auto höchstens als Transportfahrzeug für die Armee. Trotzdem stand 1914 bei einem Bedarf von 8000 Lastkraftwagen nur knapp die Hälfte zur Verfügung. Erst bei Kriegsausbruch wurde ein LKW-Beschaffungsprogramm erstellt.<p>Auf den großen, industriell geführten Krieg war die Monarchie 1914 schlecht vorbereitet. Hier nützt ein vergleichender Blick auf die Wirtschaftsdaten: Der Wirtschaftshistoriker Max-Stephan Schulze schätzt für das letzte Friedensjahr 1913 die Wirtschaftsleistung der Monarchie - zu Preisen von 1990 - auf gut 100 Millionen Dollar und die des Deutschen Reiches auf 237 Millionen, zusammen also 337 Millionen. Die Kriegsgegner der ersten Stunde, also Frankreich, Russland und das Vereinigte Königreich kommen mit zusammen 623,5 Millionen Dollar auf das Doppelte.<p>Die Rüstungsausgaben der Monarchie blieben hinter Deutschland und jenen der Feindmächte deutlich zurück. Ab 1915 wurden Betriebe und Bevölkerung über Kriegsanleihen zur Kasse gebeten. Die Produktion ziviler Güter war zusammengebrochen. In der Rüstungsindustrie waren die Arbeiterinnen und Arbeiter zu erschöpft für eine normale Leistung. Bei Skoda mussten die Menschen bei Nahrungsmangel 110 Stunden in der Woche schuften.<p>Der greise Monarch erkannte die schlimme Lage. Im Juli 1916 sagte er, so sein Biograph Karl Vocelka, zum Flügeladjutanten Margutti, dass es schlecht stehe: "Die hungernde Bevölkerung im Hinterland kann auch nicht mehr weiter . . . Im nächsten Frühjahr mache ich aber unbedingt Schluss mit dem Krieg. Ich will nicht, dass wir ganz und rettungslos zugrunde gehen!" Doch dazu kam es nicht, der Kaiser starb am 21. November desselben Jahres. Der Krieg ging weiter bis zum bitteren Ende.
Literatur:
Herbert Matis, Österreichs Wirtschaft 1848-1913, Berlin 1972.
Roman Sandgruber, Die Anfänge der Konsumgesellschaft, Wien 1982.
Felix Butschek, Organization of War Economies, in: 1914 - 1918 - online. Berlin 2016 http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10835.
Michaela und Karl Vocelka, Franz Joseph I., Eine Biographie, München 2015.
Herbert Hutar, Wirtschaftsjournalist und Historiker, war früher Leiter des Ö 1-Wirtschaftsmagazins "Saldo" und arbeitet nun als freier Publizist.