Die gesellschaftlichen Umbrüche am Ende des 1. Weltkrieges waren enorm. Chronologie der Weggabelung 1918/19.

"Meine Haare fallen mir immer noch entsetzlich aus. Ich kann mich bald nicht mehr frisieren." Diese Zeilen schrieb die Hausfrau Hedwig Lauth in einem Brief am 25. September 1917. Und sie nannte sogleich den Grund: "Es liegt an der Ernährung." Drei Jahre war der Erste Weltkrieg bereits im Gange. Längst war die Begeisterung der Verzweiflung gewichen. Allen Durchhalteparolen zum Trotz war der Alltag im Krieg nur eines: zermürbend, trost- und hoffnungslos. Die Not hatte vor allem die Städte erreicht. Die Menschen litten im dritten und vierten Kriegsjahr immer öfter an Hunger.
Die ausfallenden Haare: dieses auf den ersten Blick unscheinbare Detail vermittelt auf berührende Weise das alltägliche Gesicht des Krieges. Wenn wir die gewaltigen Umbrüche in Europa, die zwischen 1917 und 1919 erfolgten, verstehen wollen, ist es wichtig, nicht nur auf die große Politik zu blicken, sondern auch auf den Alltag der Bevölkerung im Hinterland. In Briefen und Tagebüchern kommt die Stimmung der Menschen oft deutlicher zum Ausdruck als in den offiziellen Heeresmeldungen oder Zeitungsberichten, die allesamt durch die Mühlen der Zensur gegangen waren.

Wie lässt sich der dramatische Zusammenbruch der Alten Welt im Jahr 1918 erklären? Wie kam es dazu, dass am Ende des Krieges Großreiche wie Kartenhäuser zerfielen, Monarchen voller Zorn aus dem Amt gejagt wurden? Und auf den Trümmern des Krieges hoffnungsvoll neue Republiken gegründet wurden? Wie kam es zu dieser historischen Weggabelung 1918/19, an der das 20. Jahrhundert eine andere Richtung einschlug?
Der Krieg endete in Raten. Bereits Ende 1917 schwiegen an der Ostfront die Waffen, während an der West- und Südfront noch heftig gekämpft wurde. Am 15. Dezember 1917 war ein Waffenstillstand zwischen den Mittelmächten Deutschland und Österreich auf der einen und Russland auf der anderen Seite in Kraft getreten. Nicht die Militärs waren zur Einsicht gekommen, die Kämpfe zu beenden, sondern Hunger, Not und Unzufriedenheit hatten 1917 in Russland die Menschen auf die Straße getrieben. Anfang 1917 waren die Demonstrationen bewaffneter Soldaten und Arbeiter in offene Aufstände und schließlich in die Revolution (Februarrevolu-
tion) umgeschlagen. Unter dem Ansturm des Unmuts musste der Zar abdanken, die Macht ging auf die Arbeiter- und Soldatenräte über, die sich mit den Spitzen des Militärs auf zaghafte Reformen und zunächst eine Weiterführung des Krieges einigten.
Im Oktober 1917 (nach unserer Zeitrechnung im November) desselben Jahres übernahmen schließlich die Bolschewiken die Herrschaft in Russland und drängten auf ein rasches Kriegsende. Anfang Dezember begannen die Verhandlungen für einen Waffenstillstand, der am 15. Dezember in Kraft trat. Eine Woche später, am 22. Dezember 1917, begannen die Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk, die Anfang März 1918 zum Friedensvertrag führten. Am 17. Dezember 1917 notierte die Künstlerin Käthe Kollwitz in ihr Tagebuch: "Nun ist der Waffenstillstand zwischen Rußland und Rumänien und den Mittelmächten erklärt. Anfang zum Frieden."
Ende Dezember 1917 wurden die ersten österreichischen Kriegsgefangenen aus russischen Lagern entlassen. Ein bewegender Moment, möchte man meinen. Aber die Realität sah anders aus. Die ehemaligen Gefangenen wurden auf der österreichischen Seite nicht mit offenen Armen, sondern mit Misstrauen empfangen. Die Rückkehrer seien, so hieß es in der Militärführung, in den russischen Lagern subversivem und kommunistischem Gedankengut ausgesetzt gewesen. Unter ihnen befänden sich auch zahlreiche Umstürzler, die die Unterwanderung der Truppenmoral im Sinne hätten. Die Heimkehrer wurden als Fremde wahrgenommen. auf Fotografien wurden sie häufig als Exoten gezeigt.
"Übernahmestationen"
In Eile waren von den österreichischen Behörden sogenannte "Übernahmestationen" eingerichtet worden. Insgesamt entstanden in den Wochen nach dem Waffenstillstand an der gesamten Ostfront von Riga bis Konstantinopel 24 solcher Stationen. Hier wurden die Kriegsheimkehrer in Empfang genommen. "Zweifellos", schrieb der damalige Chef der Nachrichtenabteilung des österreichisch-ungarischen Armeeoberkommandos und des Evidenzbureaus des Generalstabes, Max Ronge, nach dem Krieg, "verloren diese Heimkehrer auf ihrer Wanderung durch das revolutionäre Rußland viel von ihrer Disziplin, wurden von revolutionären Ideen angesteckt, waren also an sich mit Vorsicht zu behandeln. Wir mussten aber damit rechnen, dass die Bolschewiken in den Heimkehrerstrom obendrein ihre die Weltrevolution propagierenden Sendlinge einschmuggeln würden."
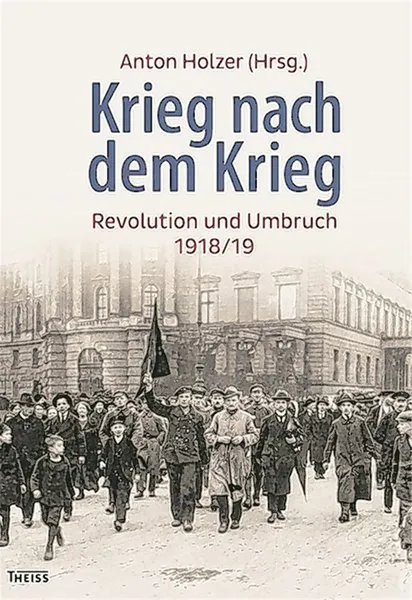
Am 3. März 1918 unterzeichneten die Mittelmächte Deutschland und Österreich den Friedensvertrag von Brest-Litowsk. Sie hatten Russland aus einer Position der Stärke heraus die Bedingungen diktiert. Im Frühjahr 1918 war also der Krieg im Osten und Südosten zu Ende. Doch im Westen wurde noch gekämpft. Aber hier begann sich, anders als im Osten, das Blatt zu wenden. Die große deutsche Frühjahrsoffensive in Frankreich scheiterte 1918, die Versorgungslage der Truppen verschlechterte sich im letzten Kriegsjahr dramatisch, der Kriegseintritt der USA 1917 hatte die Stellung der Alliierten deutlich gestärkt.
Spätestens im Sommer 1918 zeichnete sich für die deutsche Militärführung die Niederlage ab. Dass das Kriegsende schließlich so schnell kommen würde, überraschte dennoch viele. Noch am 1. Oktober 1918 hatte die Künstlerin Käthe Kollwitz in ihr Tagebuch geschrieben: "Man hat den Eindruck, der Krieg kann ewig dauern, ohne Ende." Am selben Tag aber notierte sie aber auch: "Deutschland steht vor dem Ende. Widersprechendste Gefühle."
Und tatsächlich spitzte sich im Herbst 1918 die Lage immer mehr zu. Unter dem Druck der militärischen Niederlagen erklärte sich die deutsche Militärführung zu zaghaften innenpolitischen Reformen bereit. Im Oktober 1918 traten die Sozialdemokraten in die Reichsregierung ein. Aber der Krieg ging weiter. Doch der Unmut der Bevölkerung war nicht mehr einzudämmen. "Totschießen lassen wir uns nicht mehr", schrieb ein Matrose Anfang November 1918 an seinen Vater.
Zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich das Kriegsende bereits ab. Am 3. November 1918 musste Österreich in einen Waffenstillstand mit Italien einwilligen und die Niederlage eingestehen. Tage später, am 11. November 1918, wurde im französischen Compiègne der Waffenstillstand zwischen dem Deutschen Reich und den Westmächten unterzeichnet.
Frieden ohne Ruhe
Der große Krieg war nun wirklich zu Ende. "Endlich, endlich! Das wonach wir uns in 4 Jahren fern von allem, was uns lieb war, mit heißen Sinnen gesehnt haben, ist jetzt Wirklichkeit geworden!" Dies schrieb der Soldat Wolfgang Panzer am 10. November 1918, als der Waffenstillstand unmittelbar bevorstand, an seine Familie.
Der langersehnte Frieden war nun zwar da, aber Ruhe kehrte vorerst keine ein. Hunger, Kriegsmüdigkeit und politische Unzufriedenheit schlugen Anfang November 1918 in Deutschland in offenen Protest um. Der Matrosenaufstand, der Ende Oktober 1917 in Wilhelmshaven und Kiel begonnen hatte, weitete sich Anfang November 1918 zu einem rasch um sich greifenden Massenaufstand, ja, zu einer Revolution aus, die erst im Frühjahr 1919 abflaute. In Österreich hingegen ging der große Umbruch Ende 1918 zunächst weniger turbulent über die Bühne.
"Heute ist es wahr", schrieb der deutsche Diplomat und Schriftsteller Harry Graf Kessler am 9. November 1918 in sein Tagebuch. Und er fuhr fort: "Mittags nach 1 Uhr kam ich durch den Tiergarten zum Brandenburger Tor, wo gerade die Flugblätter mit der Abdankung verteilt waren. Aus dem Tor zog ein Demonstrationszug. Ich trat mit ein. Ein alter Invalide trat an den Zug und rief: ‚Ebert Reichskanzler! - weitersagen!‘"
An diesem 9. November 1918 war in der deutschen Hauptstadt die Republik ausgerufen worden. Und zugleich hatte die Revolution die Hauptstadt erreicht. Wenige Tage später, am 11. November 1918, musste auch in Österreich der Kaiser dem politischen Druck weichen und auf sein Amt verzichten (endgültig ins Ausland ging er erst am 24. März 1919). Am Tag darauf, am 12. November 1918, rief die Provisorische Nationalversammlung im Parlament in Wien mit großer Mehrheit die Republik "Deutschösterreich" aus.
Während es in Wien zunächst ruhig blieb, standen in Berlin einander bereits am ersten Tag der Republik Bewaffnete gegenüber: aufständische Soldaten und Arbeiter auf der einen Seite und regierungstreue Polizisten und Militärs auf der anderen Seite. Am 9. November schrieb Käthe Kollwitz in ihr Tagebuch: "Die Arbeiterzüge, die Vormittag die Stadt durchzogen haben, haben Schilder vor sich hergetragen, auf denen gestanden hat: ‚Brüder! Nicht schießen!" Geschossen wurde freilich von Anfang an. Die Unzufriedenheit der städtischen Bevölkerung und der heimkehrenden Soldaten war groß, die Erbitterung nach Jahren des Krieges und des Hungers ebenso. Sie entlud sich in Aufständen gegen die Verantwortlichen. Was Anfang und Mitte November als wilde, wenig koordinierte Unruhen begonnen hatte, weitete sich in Deutschland nach und nach zu heftigen bürgerkriegsartigen Kämpfen aus, die sich bis weit in den Frühsommer 1919 hinzogen. Geprägt waren diese turbulenten Monate von Streiks und immer wieder neu aufflackernden Straßenkämpfen.
Der Journalist und Historiker Sebastian Haffner hat diese dramatische Übergangszeit zwischen Kriegsende und der endgültigen Durchsetzung der parlamentarischen Demokratie, die er als Jugendlicher hautnah miterlebt hatte, einmal als "zwielichtige Periode" bezeichnet. Es war, so formulierte er es, "eine Periode zwischen Krieg und Frieden, zwischen Kaiserreich und Revolution, zwischen Militärdiktatur und Parlamentsdemokratie". Auch Käthe Kollwitz notierte am Silvestertag des Jahres 1918: "Noch ist kein Frieden." Voller Ungewissheit blickte sie ins neue Jahr. "Der Frieden wird wohl sehr schlecht werden. Aber es ist kein Krieg mehr. Man kann sagen, dafür haben wir Bürgerkrieg."
Die Friedensverträge
Im Frühsommer 1919 begann sich die politische Lage in Deutschland allmählich zu stabilisieren. Wie labil die Situation in den Monaten zuvor gewesen war, mag man da-ran ermessen, dass die Grundzüge der jungen deutschen Republik nicht in der umkämpften Hauptstadt Berlin, sondern in der als sicher geltenden Kleinstadt Weimar erarbeitet wurden. Am 6. Februar traten die gewählten Abgeordneten der Verfassungsgebenden Nationalversammlung erstmals zusammen, am 31. Juli 1919 wurde die neue Verfassung in Weimar beschlossen. Sichtbarstes Zeichen für das Ende der Bürgerkriege war der Umzug der Nationalversammlung von Weimar nach Berlin. Dieser erfolgte am 30. September 1919.
Im Gegensatz zu Deutschland blieb die politische Situation in Österreich Ende 1918, Anfang 1919 relativ ruhig. Erst im Frühjahr und Frühsommer 1919 spitzte sich die Situation noch einmal dramatisch zu. Mitte April und Mitte Juni kam es zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen der Polizei und kommunistischen Demonstranten. Im Sommer 1919 begann sich auch in Österreich die politische Situation zu beruhigen.
Doch wirkliche politische Ruhe sollte noch länger nicht einkehren. Denn hinter den innenpolitischen Turbulenzen braute sich im Frühjahr und Sommer 1919 für die Verliererstaaten des Krieges ein neuer politischer Sturm zusammen: in Form der drakonischen Friedensbedingungen der Alliierten.
Am 18. Jänner 1919, gut drei Monate nach Kriegsende, hatten in Paris die Friedensverhandlungen begonnen. Lange Zeit wurde hinter den Kulissen gefeilscht, die Verlierermächte des Krieges, insbesondere Deutschland und Österreich (aber auch Ungarn, Bulgarien und die Türkei), hatten wenig Verhandlungsgewicht.
Schock und Empörung
Als Anfang Mai 1919 die überaus harten Friedensbedingungen mit einem Schlag öffentlich wurden, waren Schock und Empörung auf der Verliererseite groß. Die besiegten Staaten seien, so heißt es im später berühmten Paragraphen 231 des Friedensvertrags, "für alle Verluste und Schäden verantwortlich [. . .], die die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen [. . .] erlitten haben".
Die Versuche, das Diktat noch abzumildern, scheiterten. Am 22. Juni 1919 musste die in Weimar tagende Nationalversammlung unter dem massiven Druck der Alliierten entscheiden, ob sie den Vertrag annehmen oder eine Fortführung des Krieges und damit eine noch katastrophalere Niederlage riskieren solle. Sie hatte keine Wahl. Am 28. Juni 1919 setzten im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles die deutschen Vertreter ihre Unterschrift - unter Protest - unter den Vertrag.
Am 10. September desselben Jahres musste auch Österreich unter enormem Druck in die Friedensbedingungen einwilligen. Und am 4. Juni 1920 setzte schließlich auch Ungarn die Unterschrift unter den Pariser Friedensvertrag. Formell war nun Frieden in Europa eingekehrt. Aber die als ungerecht empfundenen Friedensverträge lasteten schwer auf den Besiegten. Das Trauma von Paris warf seine Schatten voraus. Als sich Ende der 1920er Jahre die wirtschaftliche Lage wieder eintrübte, erstarkten revanchistische, rechte und nationalistische Gruppen und Parteien, die neuerlich dem Krieg das Wort redeten. Gut zwei Jahrzehnte nach 1918 war der mühsam errungene Frieden schon wieder Geschichte.
Anton Holzer, geboren 1964, ist Fotohistoriker, Publizist, Ausstellungskurator und Herausgeber der Zeitschrift "Fotogeschichte". Er forscht zur Zeit mit Unterstützung der Stadt Wien zur Foto- und Mediengeschichte des Epochenjahrs 1918/19.
www.anton-holzer.at