Von der "Rackette" zur "V2" - es war der Krieg, der die Tür ins Weltall öffnete. Davor aber hatten bereits Science-Fiction-Romane die Fantasie der Theoretiker und Vordenker beflügelt.
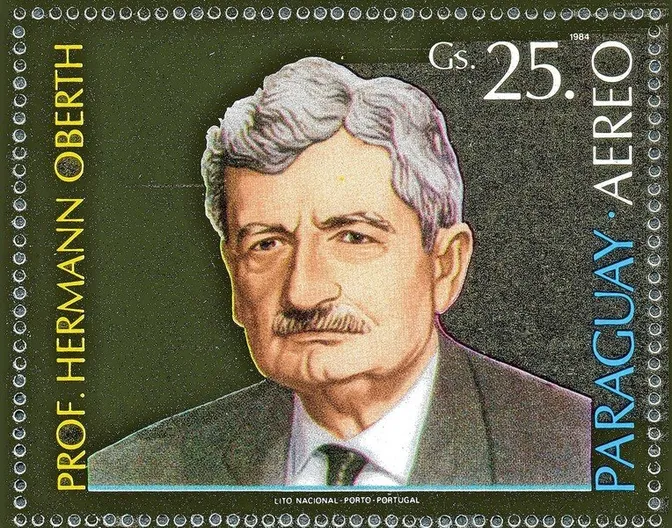
Spätestens im 13. Jahrhundert tauchen Berichte über Raketen in China und Europa auf. Die Flugkörper dienen aber nicht bloß für Feuerwerke, sondern vor allem dazu, den Gegner unter Feuer zu nehmen. Mit Schwarzpulver gefüllt, tragen sie Schwertklingen, Brandsätze oder Bomben ins feindliche Lager.
Ein früher Pionier der Kriegsraketentechnik ist der 1509 bei Wien geborene Conrad Haas. Der Zeugmeister in Hermannstadt, Siebenbürgen, bindet mehrere seiner "Racketten" zusammen oder setzt drei davon hintereinander - eine frühe Form des später in der Raumfahrt genutzten Bündelungs- bzw. Mehrstufenprinzips. Haas ersinnt außerdem glockenförmige Düsen oder deltaförmige Stabilisierungsflossen. Allerdings fallen die einschlägigen Arbeiten des Dornbachers bis in die 1960er Jahre der Vergessenheit anheim.
Im 2. Jh. hatte der Satiriker Lukian von Samosata noch einen Wirbelwind gebraucht, um die Helden seiner "Wahren Geschichten" auf den Mond zu tragen. Johannes Kepler bemühte im Roman "Der Traum" weise Geister, sein Zeitgenosse Francis Godwin in "Der Mann im Mond" hingegen abgerichtete Vögel. 1865 schießt Jules Verne seine Mondreisenden mit Hilfe einer von Artillerie-Experten entwickelten Riesenkanone ins All. Auch das widerspricht den Naturgesetzen. Dennoch werden gerade Vernes Romane "Von der Erde zum Mond" und "Reise um den Mond" die Fantasie etlicher Raumfahrtpioniere beflügeln - darunter Konstantin Ziolkowski, Hermann Oberth oder Wernher von Braun.
Der 1856 geborene deutsche Erfinder Hermann Ganswindt verlegt die Kanone ins Raumschiff selbst. Sie soll dort in rascher Folge Stahlkapseln abfeuern und das Gefährt mit dem Rückstoß tausender Dynamitpatronen vorantreiben. Noch sind es kreative Fantasten wie Ganswindt, die sich mit dem Raumflug befassen. Skeptiker zweifeln an der Machbarkeit. Das utopisch anmutende Thema bleibt somit die Domäne wissenschaftlich gebildeter Amateure.
Rückstoßprinzip
Konstantin Ziolkowski unterrichtet Mathematik im russischen Gouvernement Kaluga. Zunächst schreibt der fast taube Autodidakt die Erzählung "Auf dem Mond". Dann liest er den 1896 verfassten Artikel des russischen Erfinders Alexander Petrowitsch Fjodorow. Der schlägt Raketen als Antriebsmittel für den Raumflug vor. 1903 reicht Ziolkowski die dazu nötigen Berechnungen nach, unter dem Titel: "Die Erforschung des Weltraums mittels Rückstoßapparaten". Raketen arbeiten nach dem Rückstoßprinzip: Verbrennungsgase treten mit möglichst hohem Tempo aus und stoßen den Flugkörper mit der gleichen Kraft in die entgegengesetzte Richtung.
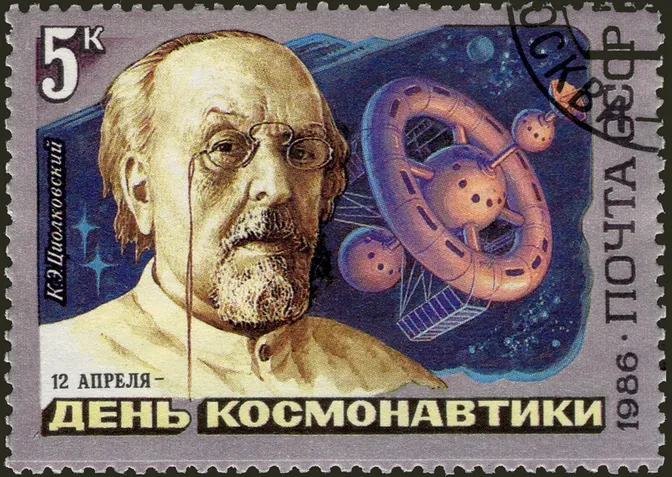
1897 leitet Ziolkowski jene grundlegende Formel ab, die man "Raketengrundgleichung" nennt. Er weiß bereits: Feststoffraketen - andere gibt es damals noch nicht - werden niemals den nötigen Schub für den Aufstieg in die Erdumlaufbahn liefern.
Doch selbst mit flüssigen Treibstoffen bliebe eine einfache Rakete zu schwer. 1929 nennt er die Lösung: "Kosmische Raketenzüge". Bei solchen Mehrstufensystemen wird die jeweils ausgebrannte Stufe beim Zünden der nächstfolgenden abgeworfen - zur Gewichtsreduktion. Außerdem will Ziolkowski mehrere Raketen bündeln und gleichzeitig zünden, um den Schub zu erhöhen. Seine Ideen werden später tatsächlich mit Erfolg umgesetzt. Zunächst nimmt man außerhalb Russlands aber wenig Notiz davon.
Die 1920er Jahre geraten zum "Wunderjahrzehnt" der Raumfahrt - zumindest, was die Entwicklung ihrer theoretischen Grundlagen betrifft. Besonders einflussreich sind die Arbeiten Hermann Oberths, der ab 1894 im schon erwähnten Hermannstadt aufgewachsen ist. An der Universität Heidelberg lehnt man 1922 seine Doktorarbeit über Fragen der Weltraumfahrt noch ab. Oberth veröffentlicht sie ein Jahr später unter dem Titel "Die Rakete zu den Planetenräumen". Der Raumflug, so das Fazit des mit Formeln gespickten Werks, ist technisch durchaus machbar!
Oberth befasst sich mit den theoretisch-technischen Grundlagen der Rakete. Auch er propagiert flüssige Treibstoffe und das Mehrstufenprinzip. Er denkt aber auch intensiv über Weltraumteleskope, Raumanzüge, die Folgen der Schwerelosigkeit und vieles mehr nach. Sein Werk ist so umfassend, dass man ihn später "Vater der Raumfahrt" nennen wird - ebenso wie den Russen Ziolkowski.
Beim Aufstieg in die Erdumlaufbahn sind nur ein paar hundert Kilometer zu überwinden. Dennoch wird das der mühsamste Teil der ganzen Reise sein. Für den Weiterflug zum Mond oder zu den Planeten bräuchte man anschließend nur vergleichsweise wenig Energie. Auf dieses "kosmonautische Paradoxon" weist Guido von Pirquet hin, geboren 1880 in Hirschstetten bei Wien. Um wirklich große Raumschiffe zusammenzubauen, müssten laut Pirquet daher zunächst ein bis drei Raumstationen im Erdorbit errichtet werden. Im eiligen Wettlauf zum Mond werden die USA und die UdSSR später allerdings auf diesen Zwischenschritt verzichten.
In Formeln gegossen
Der aus Bozen stammende Max Valier studiert Astronomie, Mathematik und Physik in Innsbruck. In München liest er Oberths Erstlingswerk. Dann konstruiert er einen Rennwagen mit Pulverraketen, finanziert von Juniorchef Fritz von Opel. Das Gefährt rast im Jahr 1928 mit gut 200 km/h über die Berliner Automobil-Verkehrs- und Übungsstraße, kurz AVUS. Eine vortreffliche Reklame für die Opel-Werke. Erst danach experimentiert Valier mit Flüssigkeitsraketen. Beim Test im Laboratorium explodiert allerdings eine Brennkammer und reißt ihn 1930 in den Tod.
Die Werke von Pirquet und Oberth faszinieren Herman Potočnik. Er kommt 1892 in Pola, Istrien, zur Welt - damals der österreichische Hauptkriegshafen. Der Sohn slowenischer Eltern
besucht die Militärakademie in Mödling. Später studiert er an der Technischen Hochschule in Wien. Potočnik zeichnet ein orbitales "Wohnrad" von 30 Metern Durchmesser aufs Papier: Beständige Rotation soll in dessen Radkranz für künstliche Schwerkraft sorgen.
Außerdem träumt er von "stehenden Satelliten", 36.000 Kilometer hoch über dem Erdäquator. Dort entspräche ihre Umlaufzeit exakt der Dauer einer Erdumdrehung - aus irdischer Perspektive stünden sie somit still. Heute richten Besitzer von SAT-Anlagen ihre Antennen auf solche geostationären Satelliten aus. Potočnik veröffentlicht das Buch "Das Problem der Befahrung des Weltraums" 1929 unter dem Pseudonym Hermann Noordung.
Die Raumflug-Träume sind nun in Formeln gegossen. Was aussteht, ist deren erfolgreiche Verwirklichung. H. G. Wells Roman "Der Krieg der Welten" (1898) inspiriert den US-Amerikaner Robert Goddard. Er will zunächst die Feststoffraketen verbessern, um damit hohe Atmosphäreschichten zu erforschen. Dann experimentiert er mit flüssigem Treibstoff.
Benzin und Flüssigsauerstoff können nicht einfach in die Brennkammer fließen, sie müssen vielmehr hineingepresst werden. Goddard setzt auf Druckgas und Pumpen. Im März 1926 gelingt ihm in Auburn, Massachusetts, der weltweit erste Start einer Flüssigkeitsrakete. Flugdauer: 2,5 Sekunden. 1935 steigt eine Rakete Goddards bereits 2.300 Meter hoch. Eine andere durchbricht im gleichen Jahr erstmals die Schallmauer.
In Deutschland existiert seit 1927 der Verein für Raumschifffahrt (VfR). Zu seinen ersten Mitgliedern zählen neben Oberth unter anderem auch Valier, Potočnik und Pirquet. Auf einem einstigen Munitionsdepot in Reinickendorf wird der "Raketenflugplatz Berlin" eingerichtet. Hier können die Enthusiasten experimentieren, verschiedene Materialien und Kühlverfahren für die Brennkammern testen oder Treibstoffmischungen ausprobieren.
900 Kilo Sprengstoff
Der deutsche Techniker Johannes Winkler ist Mitbegründer und Vorsitzender des VfR. Trotz recht bescheidener Mittel gelingt ihm 1931 der erste Start einer Flüssigkeitsrakete in Europa. Flughöhe: 100 Meter. Wernher von Braun, ein ganz junger Student aus der Provinz Posen, arbeitet am Raketenflugplatz mit. Er träumt seit der Lektüre der Werke Vernes und Oberths vom Flug ins All. Nun sieht er seine Chance.
Der Versailler Vertrag will einer Wiederaufrüstung Deutschlands Schranken setzen; Raketen bleiben darin aber unerwähnt. Die Pioniere vom Raketenflugplatz kommen dem deutschen Militär daher sehr gelegen. Schließlich übersiedeln mehrere der Männer tatsächlich nach Kummersdorf, wo sie bessere Arbeitsbedingungen vorfinden. Von Braun wird mit der Leitung der dortigen Heeresversuchsstelle für Flüssigkeitsraketen betraut.
Als die Raketen immer größer geraten, verlegt man die Heeresversuchsanstalt nach Peenemünde auf der Insel Usedom. Von Braun und seine Mannschaft entwickeln dort die A4: Sie ist vierzehn Meter hoch. Unter ihren Steuerungsgeräten stecken die beiden langgezogenen Tanks mit vier Tonnen Alkohol-Wasser-Gemisch und fünf Tonnen flüssigem Sauerstoff. Turbopumpen jagen die beiden Flüssigkeiten in die Brennkammer. Im Gasstrahl des Triebwerks führen vier motorgesteuerte Graphitruder Steuerbefehle aus; bewegliche Luftruder am unteren Ende der seitlichen Stabilisierungsflossen assistieren ihnen dabei.
1942 ist die A4 einsatzbereit, Goebbels nennt sie "Vergeltungswaffe 2" - kurz: "V2". Nun beginnt die unterirdische Serienproduktion. Weit über 5000 Exemplare werden hergestellt. An der Spitze trägt jede einzelne Rakete 900 Kilo Sprengstoff. Die Waffe schießt wie ein Blitz auf die Städte herab: Eine Unterscheidung zwischen militärischen und zivilen Zielen ist mangels Treffsicherheit unmöglich. Es gibt keinen warnenden Alarm und keine Abwehrmöglichkeit. 9000 Menschen fallen V2-Treffern zum Opfer. Mehr als 12.000 Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge sterben bei der Herstellung dieser Waffe.
Schon am 3. Oktober des Jahres 1942 ist eine A4 gut 85 Kilometer hoch aufgestiegen. Am 20. Juni 1944 erreicht ein weiteres Exemplar kurzzeitig sogar 175 Kilometer Höhe. Zwar wird die einstufige Rakete gleich wieder herabstürzen. Dennoch stößt sie, wenn auch nur ein paar Augenblicke lang, das Tor zum Weltall auf.
Christian Pinter, geboren 1959 in Wien, schreibt im "extra" seit 1991 über Astronomie und Raumfahrt.
www.himmelszelt.at