Zwischennutzung gilt als Allheilmittel gegen Leerstand und Raumnot. Kritiker sehen darin eine Vorhut der Gentrifizierung.

Wien. Der moderne Mensch muss flexibel sein. Am Arbeitsplatz. Zu Hause. In der Beziehung. Das lehren uns Unternehmensberater bei der Entlassung. Möbelkonzerne beim Entwurf der neuesten Äpplarö-Tischreihe. Mitternachtsflirts beim nächsten Wisch über das Handy-Display. Das Leben als Provisorium begreifen. So hat es eine ganze Generation gelernt. So lebt sie es, Tag für Tag. Ihre Devise: Mach es dir bloß nicht zu gemütlich, morgen kann alles wieder ganz anders aussehen. Der Ist-Zustand ist nur ein flüchtiger Moment. Es besteht also kein Grund, sesshaft zu werden. Weder physisch noch mental.
In der Stadtentwicklung hat man für dieses neue Nomadentum einen Namen gefunden: Zwischennutzung. Gefeiert wird das Konzept in den Metropolen der Welt. Für die einen ist es das Allheilmittel gegen verwaiste Straßenzüge, heruntergekommene Bürobunker und verlassene Industriebrachen. Hier kann sich eine junge Kreativwirtschaft für ein paar Monate oder gar Jahre austoben. Ein Atelier da, ein Start-up-Büro dort. Günstig und unkompliziert. Gezahlt werden lediglich die Betriebskosten. Der Immobilieneigentümer bekommt so seine Leerstandskosten ersetzt und die Räumlichkeiten werden gepflegt. Das ist der Pitch der Befürworter. Eine klassische Win-win-Situation. Oder?
Nein, sagen die Skeptiker. Für sie ist Zwischennutzung lediglich die Vorhut der Gentrifizierung, ein Instrument, das vor allem der Immobilienwirtschaft in die Hände spielt. Sie weiß, was die hippe Fahrradwerkstatt, der dänische Pop-up-Papierstore und der Proberaum für die laktoseintolerante Pantomime-Gruppe für einen Häuserblock bedeuten. Geld. Viel Geld. Wer sich das Hippe ins Erdgeschoß lockt, kann sich der Reichen am Dach bald sicher sein.

Jutta Kleedorfer sieht diese Entwicklung entspannt. "Natürlich passiert Gentrifizierung. Wenn das aber in einem Tempo passiert, in dem die meisten mitgehen können, muss man auf die paar, die es sozial nicht schaffen, gut schauen und deswegen doch bitte nicht alles verhindern", sagt sie. Seit 25 Jahren arbeitet die Raumplanerin für die MA18, dem Magistrat für Stadtentwicklung und Stadtplanung. In der Stadt Wien ist die 63-Jährige die Frau für Zwischennutzung. Bis zu zehn Anfragen hat sie pro Woche. Jeder will plötzlich das Kellerlokal in seiner Straße oder das Lager in seinem Lieblingsviertel temporär nutzen. Man hat das bei anderen gesehen und will sich nun auch ausprobieren. Vor knapp vier Jahren hat der Hype begonnen. Mit "Trust 111", einem alten Zinshaus in der Schönbrunner Straße im 5. Bezirk. Künstler und Architekturstudenten hatten aus der heruntergekommenen Immobilie auf mehreren Etagen eine eigene Welt aus Ateliers, Jugendherberge und Partyräumen geschaffen. In den Medien wurde das Projekt als Innovation bejubelt, ihre Betreiber, die niederländische Stadtgeografin Margot Deerenberg und der Vorarlberger Architekt Lukas Böckle, als Visionäre gefeiert. Heute gelten die beiden als Koryphäen und als erste Anlaufstelle in Wien, wenn es um das Thema Zwischennutzung geht. Sei das im Verein Paradocks, unter Deerenbergs Ägide, wo im alten Bundesrechenzentrum in der Marxergasse 18 im 3. Bezirk Räume an Zwischennutzer vermittelt werden oder in Böckles Agentur Nest, die sich als Raumunternehmer begreift und es sich zum Ziel gesetzt hat zehn Prozent des gewerblichen Leerstands in Wien mit ihrer Arbeit zu reduzieren.
Das Projekt in der Schönbrunnerstraße war ein kurzes Gastspiel. Ein Brand hat sie 2013 gezwungen, das Haus nach einigen Monaten zu räumen. Mittlerweile ist die Immobilie längst saniert - inklusive der 12 Dachgeschoßwohnungen.
Raum als Politikum hat ausgedient
Doch noch heute schwärmt Kleedorfer von Trust 111. Einzigartig war das damals, erinnert sich Kleedorfer und googelt in ihrem Videoarchiv nach der Sequenz eines Interviews, in dem selbst der Eigentümer von den jungen Künstlern schwärmt, die sein Haus belebt haben. Das Haus habe ein Umdenken bewirkt, vor allem bei den Immobilienbesitzern. Plötzlich war da ein Schalter umgelegt worden, meint Kleedorfer. Denn in der Regel fürchten sich Hauseigentümer vor den "Zwischennutzern." Man wisse ja nie, wann sie wieder gehen würden. Und ob sie das Haus nicht gar besetzen würden. So wie es die jungen Leute früher schon einmal gemacht haben in der Arena, im WUK oder im Amerlinghaus. Doch die jungen Leute von damals haben nichts mehr mit den jungen Leuten von heute gemein. Der eigene Lebenslauf geht über alles. Es gilt die Ich-AG zu kuratieren. Und ein besetztes Haus macht sich eben nicht so gut im Lebenslauf, wie das Start-up-Projekt.
Es ist eine monoethnische, gebildete und mitunter privilegierte Klientel, die diese Räume heute bespielt. Sie weiß, an welche Stelle sie sich wenden muss, wie sie Anträge ausfüllt und mit welchen Leuten sie netzwerken muss, um das fehlende Kapital aufzustellen um das eigene Büro mit dem nötigen Shabby chic Inventar auszustatten. "Wir sind nicht bei den Ärmsten der Armen", gesteht auch Kleedorfer. "Es gibt bestimmte Anliegen, die man politisch durchfechten muss."
Raum als Politikum scheint ausgedient zu haben. Der Zeitgeist spielt Politik und Immobilienwirtschaft in die Hände. Das beobachtet auch Willi Hejda, Vorstandsmitglied der IG Kultur, einer Interessengemeinschaft der freien und autonomen Kulturarbeiter. Zwischennutzung als niederschwelliges Raumangebot für einkommensschwächere Gruppen zu verstehen, ist eine Illusion: "In Wien ist es teilweise so, dass Zwischennutzungen, die über Zwischenstationen vermittelt werden, nichts mehr mit Zwischennutzungen zu tun haben. Da zahlen die Leute schon einmal zehn Euro pro Quadratmeter. Das ist nur eine andere Form von Mietverhältnis für mich", kritisiert er.
Einkommensschwächere Gruppen sind somit ausgeschlossen. "Ich sehe das überhaupt nicht so. Es ist schon unsere Anliegen, dass das in den sozialen Bereich reingeht", sagt Jonathan Lutter. "Es ist medial vielleicht ein bisschen schwerer verkaufbar. Es ist nicht ganz so sexy. Die Kreativwirtschaft und die Künstler werden in den Vordergrund gestellt, aber wir sehen es als unsere Aufgabe, da einen großen Bogen zu spannen." Der Architekt gehört zu den sechs Mitarbeitern der neuen Agentur für Zwischennutzung der Stadt Wien. Bereits 2010 hat die rot-grüne Stadtregierung in ihrem Regierungsübereinkommen beschlossen, eine Servicestelle zu schaffen, um "kulturelle Freiräume und Zwischennutzungen von leer stehenden Gebäuden, Brachflächen und Baulücken in allen Stadtteilen" zu ermöglichen, indem aktiv Meldungen über Leerstände von städtischen, bundeseigenen oder privaten Räumen gesammelt und auf Anfrage angeboten werden sollten." Sechs Jahre später war es schließlich so weit. Im Mai 2016 wurde die "Agentur für kreative Räume" ins Leben gerufen. Betrieben wird sie von Ula Schneider, der Begründerin des Straßenfestivals Soho in Ottakring, und dem Ingenieur-und Designbüro Kohlmayr/Lutter/Knapp, das in den vergangenen Jahren vor allem mit der Umgestaltung von Räumen in Erdgeschoßzonen zu "Grätzelhotels" von sich Reden gemacht hat.
Sich einen Überblick über das leere Angebot in der Stadt zu verschaffen, stellt sich für die Agentur noch als Herausforderung dar. Weder die Stadt noch die privaten Anbieter gehen mit Informationen über ihren Leerstand hausieren. Offizielle Zahlen werden keine erhoben. Weder über die Zahl leerer Wohnungen noch jener leerer Gewerbeflächen. So muss die Agentur damit arbeiten, was ihr herangetragen wird. Ihr Ziel ist es in erster Linie, Kontakte und Netzwerke aufzustellen und zu lobbyieren. Es gilt Bauträger und Immobilienentwickler dafür zu gewinnen ihren Leerstand zu aktivieren. Die Nachfrage nach Räumlichkeiten ist groß. Allein in den vergangenen vier Monaten haben sich knapp 100 Interessenten bei der Agentur gemeldet. "Wir vermitteln nicht. Das dürfen wir nicht. Wir haben keine Maklerkonzession", stellt Jonathan Lutter klar. "Wir sehen uns als Sprachrohr und Trampolin für die größeren Anbieter, die es hier gibt wie Nest und Paradocks."
Inwieweit der Bogen von kreativer Hipsterblase zu einkommensschwächeren Gruppen gespannt wird, kann nun noch nicht gesagt werden. "Es ist unglaublich schwierig, wenn jemand überhaupt kein Geld und keine Struktur hat", sagt Ula Schneider. Aus Erfahrung weiß die Soho Ottakring Initiatorin, wie schwer Zwischennutzungsprojekte in diesem Feld sein können: "Wenn überhaupt keine Struktur da ist, gerät man schon schnell an die Grenzen."
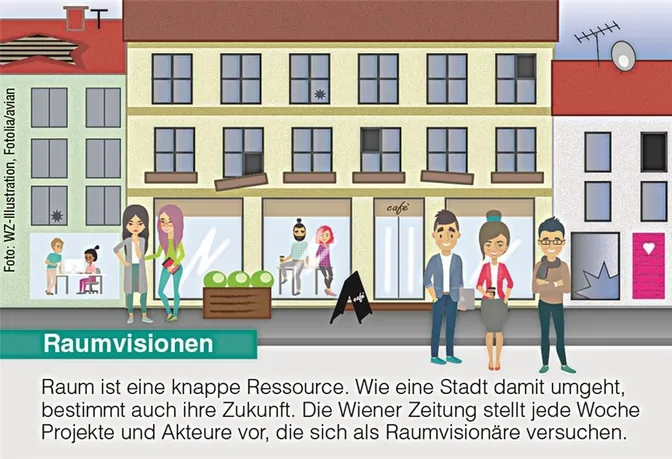
Wie die Agentur in Zukunft damit umgeht, kann sie heute noch nicht sagen. Noch stehe man ganz am Anfang. Man hat einmal sein Büro, einen Container am Gelände vom Media Quarter St. Marx, bezogen. Anfang Oktober sollen hier die ersten Konzepte vorgestellt werden.
450.000 Euro sind für die Serviceagentur budgetiert. Die Kosten teilen sich das Finanz-, Stadtplanungs- und Kulturressort der Stadt Wien zu gleichen Teilen. Vorerst ist das Projekt auf drei Jahre angelegt. Danach wird evaluiert. Und beschlossen, ob die Agentur weiter bestehen soll. Denn auch sie ist am Ende des Tages nur eines: eine Zwischennutzung.